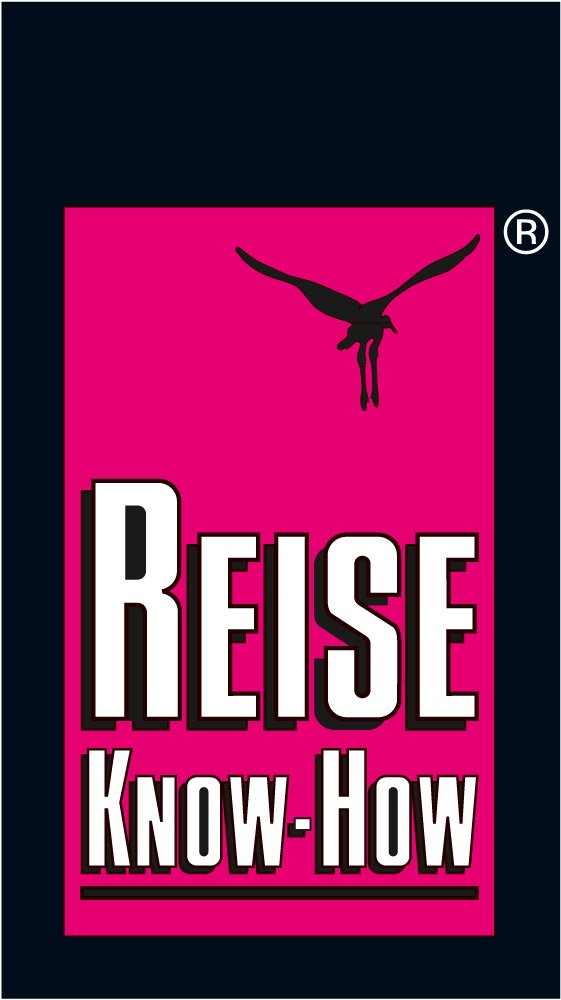Wir besaßen einen ganz normalen VW-Campingbus, der uns aber für eine lange Reise zu klein war. Eine Weile liebäugelten wir mit anderen, größeren Fahrzeugen, kamen aber schließlich auf den VW- Hochraumkastenwagen zurück. Dieses Modell kauften wir im Sommer 1970 fabrikneu und ohne Inneneinrichtung und dachten, in ein paar Monaten mit dem Selbstausbau fertig zu sein. In Wahrheit arbeitete ich bis kurz vor der Abreise am Auto.
Um die Reise detailliert zu planen, klapperten wir alle Bibliotheken ab und sammelten soviele Informationen wie nur möglich. Das war bei weitem der schönste und attraktivste Teil unserer Vorbereitungen. Mit jedem Buch packte uns die große Vorfreude mehr, zumal wir wußten, daß wir all die schönen Plätze wirklich besuchen würden. Besonders für den ersten Teil der Reise betrieben wir derart intensive Forschungen, daß wir uns einen eigenen Reiseführer schrieben und tatsächlich sehr genaue Vorstellungen entwickeln konnten, welche Länder und Orte wir wie lange besuchen wollten.
Vor allem aus klimatischen Gründen hatten wir die Abfahrt auf den 1. Oktober 1971 festgelegt. Obwohl wir einen ziemlich genauen Zeitplan für die tausenderlei Erledigungen - Kündigungen, Wohnungsauflösung, Impfungen etc. - vorbereitet hatten, blieb uns in den letzten beiden Monaten keine freie Minute; die Probleme überstürzten sich. Besonders das Wohnungsauflösen kostete Zeit und Nerven. Wir wollten nur die wertvollsten und wichtigsten Dinge aufheben und bei Verwandten unterstellen, alles andere sollte verkauft, verschenkt oder auf den Müll geworfen werden. Die Wohnungseinrichtung mit allen Möbeln konnten wir komplett verkaufen. Den Rest, den wir nicht aufheben wollten, mußten wir unter großem Zeitaufwand loswerden, d.h. meist auf den Sperrmüllplatz bringen.
An meinem letzten Arbeitstag am 30. September saß ich vor Erschöpfung wie ein Toter am Schreibtisch. Auch die Abschiedsfeier mit meinen Kollegen konnte mich nicht mehr aufmuntern. Am nächsten Tag, dem geplanten Abfahrtstag, waren wir zu kaum einem Handschlag fähig; obwohl die neuen Mieter bereits vor der Wohnungstür standen. Schließlich verließen wir Deutschland am 4. Oktober 1971 nachmittags - erschöpft und ohne große Empfindungen.
Die Route über Belgrad, Sofia, Istanbul, Ankara nach Teheran kennen wir von früheren Reisen gut. Daher widmen wir die ersten Reisetage nur der Erholung. Einer von uns beiden sitzt am Steuer, der andere liegt hinten im Bett und regeneriert sich. Doch in Ankara bereits melden sich die ersten Reise-Probleme. Andere Touristen erzählen, daß die iranische Grenze geschlossen sei, weil der Shah das 2500- jährige Bestehen des Perser-Reiches feiert. Aber genaue Auskunft kann uns weder die persische noch die deutsche Botschaft geben. Wir fahren ein wenig langsamer, um erst gegen Ende der Jubelfeier an der Grenze anzukommen.
Es ist der 15. Tag der Reise. Wir schlafen in Erzurum, einer zugigen und kalten Stadt im Osten der Türkei. Als wir morgens aus den Schlafsäcken kriechen, ist die Wasserleitung eingefroren. Zum Aufwärmen fahren wir zunächst eine Weile und frühstücken abseits der Straße in der Morgensonne. Bald brechen wir auf und treffen nicht weit entfernt zwei Amerikaner, die um die Erde wandern. Ihr Gepäck transportieren sie mit einem kleinen Pferdewagen, auf den sie geschrieben haben "first walk around the world". Ein gutes Jahr später treffen wir die beiden Wanderer in Afghanistan wieder - einen Tag bevor der eine erschossen und der andere schwer verletzt wird.
Von Erzurum führt die Straße über einige einsame Pässe und trifft am Fuß des Großen Arrarat auf die iranische Grenze. In einer engen Serpentine stehen plötzlich zwei Männer mitten auf der Straße. Der eine richtet seine Pistole auf uns. Wir stoppen. Der Pistolenheld kommt zum Fenster und gestikuliert uns irgendetwas zu. Sigrid sagt: "Fahr weiter".
Doch schon beim ersten Ruck zieht der Bursche seine Pistole und zielt aufs Vorderrad. Er gibt sich als Polizist aus, Sigrid fragt nach seinem Polizeiausweis. Da hält er lässig seine Pistole hin. Wir verstehen soviel, daß sein Begleiter bis zum nächsten Dorf mit uns fahren wolle. Eine Weile versuchen wir noch, die Gäste hinzuhalten. Wir hoffen, daß vielleicht ein anderes Auto vorbeikommt. Aber nichts ist zu hören. Sigrid öffnet die Türverriegelung und will den Begleiter einsteigen lassen. Aber der angebliche Polizist drängelt auch hinterher. Da faßt Sigrid Mut, schiebt den Mann raus, dem Polizisten auf die Füße. Ich fahre an, die beiden stolpern, Sigrid reißt die Tür zu und wir hauen ab, so schnell es nur geht. Kein Schuß fällt, nach fünf Minuten atmen wir erleichtert auf.
Am späten Nachmittag erreichen wir die Grenze. Voller Spannung fahren wir um die letzte Kurve - die Grenze ist geöffnet. Auf der persischen Seite lernen wir einen deutschen LKW-Besitzer kennen, der zwischen München und Teheran hin- und herpendelt.
Er erzählt uns wilde Geschichten von Überfällen in diesen Breitengraden. Aber auch davon, wie er Pornohefte nach Persien und Teppiche nach Deutschland schmuggelt. Ein halbes Jahr später treffen wir ihn an der bulgarischen Grenze wieder: gerade in dem Augenblick, als Polizisten 50kg Haschisch aus seinem Ersatzreifen leeren und ihn für diverse Jahre hinter bulgarischen Gittern verschwinden lassen.
Nach einer Woche verlassen wir Persien. Die Grenze nach Afghanistan liegt halbwegs in der Wüste. Ein Soldat am Schlagbaum begrüßt uns. Seine Uniform scheint schon der Großvater getragen zu haben. Als bei der Andeutung von Salutieren seine Hand an die Hose schlägt, löst sich eine Staubwolke. Die Grenzabfertigung der Afghanen scheint in jedem Einzelfall ein kleines Ereignis zu sein, wir amüsieren uns über die schwerfällige und furchtbar umständliche Bürokratie.
Afghanistan ist das erste fremde Land unserer Reise. In Herat, der großen Stadt im Westen, traben Pferdedroschken mit Gebimmel über die Straße. Die Frauen gehen tief verschleiert, die meisten Häuser sind aus Lehm gebaut. Wo auch immer wir anhalten, sofort ist das Auto von einer Menschentraube umlagert. Wir müssen die Leute mit der Tür zur Seite schieben, um aussteigen zu können.
Die Menschen sind herzlich, freundlich und ungehemmt neugierig. Jedes fremde Ding müssen sie anfassen, um es zu "erfassen". Sei es ein fremdes Auto oder eine Kamera. Im letzten Fall führt das hin und wieder zu Mißverständnissen.
Ein Wüstenvolk wie die Afghanen entwickelt ein ganz besonderes Verhältnis zum Wasser. Nie werden wir das Restaurant an der Hauptstraße vergessen. Der "Ober" geht mit den Tellern vor die Tür, bückt sich, reibt sie mit der Hand im schwarz-brackigen Abwasserkanal ab und stellt sie vor uns auf den Tisch. Wortlos verlassen wir das Lokal, wie selbstverständlich schiebt der Ober die Teller dem Nachbarn hin. Mit kostbarem, frischem Wasser etwa Teller abwaschen, das wäre Verschwendung.Herat gefällt uns. Immer wieder freuen wir uns über die unverfälschte und offene Art der Menschen. Bei der Weiterreise dehnen wir unsere Liebe auf dieses ganze wilde Wüstenland aus. Sei es die faszinierende Gebirgslandschaft des Hindukusch oder die brettflache Seistan-Wüste im Süden, immer wieder sind wir begeistert.
Von der kleinen, mehr wie ein einziger orientalischer Bazar wirkenden Hauptstadt Kabul aus machen wir einen Abstecher nach Norden. Die Straße schraubt sich atemberaubend in den Hindukusch hinauf, ein Tunnel in 3800 m Höhe durchquert den Gebirgsriegel. Langsamer, einem wildromantischen Bach folgend, führt sie hinunter nach Mazar-i-Sharif. In diesem Wallfahrtsort finden wir die schönste Moschee im persischen Stil außerhalb des Iran.
Wieder einmal bringen uns Gerüchte in Konflikte. Plötzlich geistert der 17. November als Kriegsbeginn zwischen Indien und Pakistan durch aller Mund. Wir beeilen uns. Am 16. November überqueren wir den berühmt-berüchtigten Khyber-Paß, der nur 1200 m hoch ist, dessen steile Felswände jedoch mit Erinnerungstafeln übersät sind für eng-lische Regimenter, die hier verbluteten. Auf der anderen Seite er-wartet uns das Indusbecken.
Soviel Grün auf einmal tut weh, wenn man so lange nur Stein und Wüste sah. Es verändert auch die Stimmung. Die Herausforderung der Wüstenlandschaft wechselt über in eine Art Unbesorgtheit: hier fällt einem die reife Banane in den Mund, dort mußte man kämpfen darum. Wir fahren zügig durch Pakistan und gehen am 17. November über die Grenze nach Indien.
Die Zöllnerin auf der indischen Seite ist uns seit langem bekannt. Um ein paar hundert Filme und 7000 Rupies ins Land zu bringen, laden wir die Dame zu einer Tasse Tee ins Auto. Auf dem Tisch liegt unser Geldbeutel mit 300 indischen Rupies. Sofort schaut sie hinein, erzählt uns, die Einfuhrvon indischen Rupies sei verboten - und läßt 100 Rupies in ihrem BH verschwinden.
Unkontrolliert betreten wir das Land. Fünf Minuten später halten wir. Hohe Platanen werfen Schatten über die Straße, ein Teppich von Lotosblumen liegt auf einem Teich, Vögel zwitschern in den Bäumen, Blumenduft zieht betörend von der Wiese her; wir umarmen uns vor Glück. Das ist der erfüllte Traum: Wir stehen wirklich und wahrhaftig auf indischer Erde.
Damals lag der Grenzübergang noch bei Ferozipur. Wir wollen Amritsar besuchen und müssen unterwegs endlose Armeekolonnen kreuzen - die Kriegsgerüchte scheinen nicht aus der Luft gegriffen. In Amritsar fragen wir nach einem Platz zum Übernachten. Ein Polizeioffizier bietet uns an, im Goldenen Tempel zu parken.
Da stehen wir nun mit unserem Auto im Vorhof des Goldenen Tempels. Der Duft von Jasminsträuchern erfüllt den Wagen, vom Tempel her hören wir das Harmoniumspiel und die liturgischen Gesänge der Sikh- Priester. Später in der Nacht gehen wir hinüber. Der Tempel ist eine Insel in einem großen Wasserbecken, eine zierliche Brücke verbindet ihn mit dem Land. Die vergoldeten Außenwände schimmern matt im Mondschein, das zarte etwas unwahre Bild spiegelt sich im Wasser. Wir sitzen auf immer noch sonnenwarmen Marmorfliesen am Beckenrand, Traum und Wirklichkeit verweben sich miteinander.
Wir treffen andere Deutsche, die uns von einem Heiligen erzählen, dessen Lehre viele Leute aus der ganzen Welt anziehe. Gemeinsam besuchen wir Dera Baba Jamail Singh, den Ort seines Wirkens. Ein Diener führt uns ins Gästehaus, das zwischen Blumenrabatten in einem schattigen Park liegt. Etwa 30 Gäste aus Europa, Südafrika und USA versammeln sich zum Abendessen. Wir erfahren, daß der "Master" juristisch gesehen der Vorstand der Sekte ist. Praktisch jedoch gibt es keinen Zweifel, daß er den christlichen Gott beider Konfessionen, den jüdischen Gott, Allah, Brahma und sogar Buddha hier auf Erden stellvertritt.
Nach dem Essen werden wir zur Privataudienz beim Master geladen: ein Sikh von der Tracht her, etwa 40 irdische Jahre alt, wohlgenährt und gutaussehend, vollendete Manieren. Bei unseren Fragen nach dem Inhalt seiner Verkündung verweist er uns auf die Bibliothek des Hauses. Er interessiert sich hauptsächlich für Sigrids Schmuck aus Afghanistan. Zum Schluß lädt er uns zu weiterem Aufenthalt ein und bietet uns die Initiation an.
Nach einer gemeinsamen Gebetsstunde aller Gäste klärt uns ein holländischer Pilot, der zum europäischen Stellvertreter des Stellvertreters erkoren ist, auf, daß uns der Master aus München hierher gerufen habe. Die Initiation bedeute, daß man in den Kreis der Ausgewählten aufgenommen und vom Rad der Wiedergeburten befreit werde. Wie auch von der Last des irdischen Besitzes, der möglichst bargeldlos auf des Masters Konto überzugehen habe. Wir nehmen die Einladung gern für drei Tage an, gehen aber der Initiation aus dem Weg.
Der Abschied fällt etwas kühl aus, als wir zur Weiterreise nach Dehli aufbrechen.
Den neuen Teil der Hauptstadt Indiens - New Dehli - haben die Engländer gebaut. Man spürt noch über die üppig wuchernden Bäume, Blumenund Sträucher hinweg das britische Understatement, ein bißchen auch die Kühle. Alt-Dehli dagegen ist ein brodelnder Hexenkessel mit winkeligen Gassen, in denen sich Autos aller Jahrgänge, Ochsen- und Eselskarren, heilige Kühe, Fahrräder, Rikschahs, Lastenträger und unzählige Fußgänger drängeln.
Am Rand des Kessels liegt das Rote Fort, hinter dessen Mauern schattige Ruhe herrscht. Einer der Marmor-Pavillions dort ist so schön geraten, daß die überwältigten Erbauer in die Decke meißeln ließen: "Wenn es ein Paradies gibt auf Erden, so ist es hier, ist es hier".
In Dehli erfahren wir definitiv - im Gegensatz zu Auskünften indischer Stellen in Deutschland - daß Touristen höchstens sechs Monate in Indien bleiben dürfen. Erst nach einem halben Jahr dürfen sie erneut einreisen. Sechs Monate aber reichen uns nicht für dieses riesige Land. Wir überlegen lange, wo wir das halbe Jahr außerhalb Indiens verbringen sollen. Wenn wir für diese Zeit nach Deutschland fahren, könnte Sigrid Reise-Fotos auswerten, während ich mir einen vorübergehenden Job suchen müßte. Wir entscheiden uns für diese gar nicht schlechte Lösung: vor der indischen Regenzeit in den deutschen Sommer zu flüchten und vor dem deutschen Winter in die indische Trockenzeit. Dementsprechend legen wir die Route für diesen Reiseabschnitt fest. Wir wollen mehr oder weniger den äußeren Umrissen Indiens folgen, Nepal besuchen und etwa im März des kommenden Jahres in Richtung Deutschland aufbrechen.
Am Abend vor der Abfahrt aus Dehli schmilzt beim Kuchenbacken der Gasschlauch am Küchenherd. Niemand ist im Wagen. Zufällig entdecke ich von außen die lodernde Flamme, schreie "Feuer, Feuer" und finde vor Aufregung den Feuerlöscher nicht - obwohl wir täglich darüber stolpern. Endlich kann ich ihn aus der Halterung reißen und einen kräftigen Strahl in die Flammen schießen. Das Feuer erlischt, im letzten Moment. Der Innenraum des Autos ist rußgeschwärzt; unser Kuchen schmeckt nach Feuerlöschmittel.
In Udaipur genießen wir den Sonnenuntergang am See. Besser als je zuvor empfangen wir die Nachrichten der Deutschen Welle. Die Schlagzeile "Kriegsausbruch zwischen Indien und Pakistan" läßt uns den friedlichen, weltabgeschiedenen See vergessen. Wir fahren - wie auch andere Wagen - mit Standlicht zurück in die Stadt. Plötzlich hören wir Geschrei. Ein Lastwagen vor uns hält an, Inder zerren den Fahrer aus dem Führerhaus. Schon sind auch wir umzingelt. Wir vergaßen die Schiebetür abzuschließen, die Inder stürmen ins Auto. Wütend springt Sigrid nach hinten und treibt die Burschen widerstandslos aus dem Wagen. Ich fahre an, biege in eine Seitenstraße ab: ohne jedes Licht im Stockdunklen, die Straße nur am dunkel sich abhebenden Asphalt erahnend. Irgendwie finden wir zu einem sicheren Rasthaus, auf dessen Parkplatz wir übernachten.
Am nächsten Tag fahren wir weiter auf den Mount Abu. Dort oben, auf der Höhe eines Mittelgebirges, genießen wir unglaublich schöne Tempel der Jains, (eine sehr alte Hindu-Sekte). Alle Innenwände sind mit hauchzarten, filigranhaften Marmorschnitzereien verziert. Wir haben nirgends auch nur annähernd Ebenbürtiges wieder gesehen.
Nach der Stille des Mount Abu trifft uns in Ahmadabad die Wirklichkeit des Krieges. Morgens erreichen wir die Stadt. An einer der ersten Kreuzungen stoppt uns ein Polizist. Er spricht nicht englisch und fragt dann die Passanten, wer uns übersetzen könne, daß wir als Spione gesucht würden. Im Nu kreisen hunderte von Menschen unser Auto ein - leibhaftige Spione sieht man nicht alle Tage. Wir müssen eine Stunde warten, bis wir im Polizei-Konvoi mitsamt Auto abtransportiert werden. Diese Stunde zählt zu den riskantesten unseres Lebens. Zum Glück hören wir erst später, daß häufig bei solchen Gelegenheiten die Autos samt Insassen angezündet werden...
Ein Inspektor verhört uns stundenlang. Das Auto wird durchsucht. Nach einem zermürbenden halben Tage geht er endlich darauf ein, warum wir verhaftet sind. "Was haben Sie gestern Mittag verbrannt?" fragt er. Ich erzähle, daß wir in Dehli Straßenkarten gekauft hatten, derenRandgrößer als die Karte selbst war. Ich schnitt mittags alle Ränder ab, um die Karten handlicher zu machen. Das Abfallpapier verbrannte ich. Eifrige Inder untersuchten die Asche und konnten Städtenamen mit Planquadratangaben lesen. Ich hole die Karten, der Inspektor läßt sich schließlich überzeugen. Im Polizeischutz werden wir zu unserer Sicherheit aus der Stadt geleitet.
Wir erleben Bombay während des Krieges und dürfen nicht einmal historische Bauwerke fotografieren. Ein hysterischer Inder hört angeblich pakistanische Flugzeuge, benachrichtigt die Flugabwehr, diese eröffnet Abwehrfeuer. Von den herunterfallenden Flakgranaten werden die einzigen Kriegsopfer Bombays getötet - Flugzeuge waren nie in Sicht.
Einen Tag nach Kriegsende erreichen wir Goa. Und dort finden wir unser Paradies, auch heute noch für uns der schönste Platz der Welt(obwohl wir viele schöne Plätze sahen). Ein Felsenhügel steigt aus dem Meer empor, nur eine einzige Palme nimmt er sich als Schmuck. Unter dieser Palme wohnen wir. Kein Mensch weit und breit. Vor uns liegt das Meer, auf dem Lastensegler vorbeiziehen oder nachts weit draußen vor Anker gehen. Delphine spielen in der Bucht, zu beiden Seiten unseres Felsens goldgelbe Sandstrände, dahinter wiegen sich Palmenwälder im Wind.
Wir verleben vier glückliche Wochen, Weihnachten und Neujahr im Paradies. Allein mit uns, dem Meer und den Palmen. Nur schwer können wir uns trennen und nehmen uns fest vor, im nächsten Jahr zurückzukehren.
Wir folgen der Westküste der indischen Halbinsel bis zu deren Spitze am Cape Comorin. Unterwegs erleben wir Wasserfälle ohne Wasser - weil es stattdessen ein Kraftwerk treibt -, sehen sehr schöne Tempel in Belur und Halebid, finden den saubersten Markt Indiens in Mysore und einen Wildpark ohne Wild, aber mit schöner Landschaft in Mudumalay.
Cape Comorin ist die einzige Stelle Indiens, wo man Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Meer erleben kann. Morgens stehen fromme Hin-dus auf den Felsausläufern des indischen Subkontinents und begrüßen die aufgehende Sonne mit Gesängen, abends verabschieden sie den un-tergehenden Feuerball. Anschließend hocken viele zwischen den Fels-spalten und entleeren ihren Darm. Man muß nach Sonnenuntergang auf-passen und um die stinkende Hinterlassenschaft herumbalancieren.
Inder kennen bei natürlichen Bedürfnissen keine Scheu. Immer wieder erlebt der Reisende, wie besonders am frühen Morgen ganze Dorfgemeinschaften am Straßenrand hocken, das nackte Hinterteil in die Sonne haltend. Wasser, meist in einer Büchse mitgenommen oder mit der hohlen Hand aus dem Fluß geschöpft, dient anstelle von Toilettenpapier der abschließenden Reinigung. (In Dehli übernachteten wir stets auf einem Platz der Pfadfinder. Obwohl Toiletten vorhanden waren, zogen es fast alle jungen Leute vor, mit der Wasserbüchse in den umliegenden Büschen zu verschwinden.)
Cape Comorin bedeutet für uns den Wendepunkt: wir folgen jetzt der Ostküste nach Norden. Wir besuchen die großen südindischen Tempelanlagen, die von außen Festungen gleichen, innen meist wie kleine Dörfer wirken. An den äußeren Mauern liegen Wohnungen und Geschäfte, weiter im Innern nimmt der weltliche Betrieb ab, der Dienst der Priester zu. Das Allerheilige dürfen nur Hindus betreten.
In Mahaballipuram bei Madras bewundern wir das größte Basrelief der Welt: eine Felswand ist über und über mit Darstellungen aus der hinduistischen Mythologie geschmückt. Madras selbst gehört zu den weniger schmutzigen indischen Städten. Es besitzt den größten Hafen Südindiens. Ich lasse in einer Werkstatt, an der ein selbstgemaltes VW-Schild hängt, einen der üblichen Kundendienste machen. Die Mechaniker dort verwirklichen ihre eignen Vorstellungen von Motor- Einstellungen, vor allem erledigen sie alles nur nach Gefühl. Nachdem fünf Leute einen halben Tag lang ständig irgendwo am Auto herumgefummelt haben, zahle ich 10 DM - und fahre nur bis zum allernächsten Platz, um alle Arbeiten zu überprüfen. Dabei stelle ich fest, daß die Herren nahezu alles falsch eingestellt hatten, was sich überhaupt verstellen ließ.
Wir fahren weiter in das Gebiet um Bhubanesvar, Konarak und Puri. In Konarak steht eine schöne, alte Tempelruine mit erotischen, in Stein gehauenen Darstellungen. Als englische Forscher zum ersten Mal diese Anlage sahen, verschwiegen sie wegen der "anstößigen" Bilder schamvoll ihre Entdeckung.
In Puri fahren wir durch winklige Gassen zum großen Tempel der Stadt. Plötzlich sehen wir ein alptraumhaftes Bild. Vor uns, auf den letzten hundert Metern zum Tempel, sitzen leprakranke Bettler, einer neben dem anderen. Hundert oder mehr Armstümpfe recken sich bettelnd auf; hilflose, entstellte Gesichter flehen um eine Gabe.
Durch ein Gebiet, in dem erst kürzlich ein Wirbelsturm hauste, führt unser Weg nach Calcutta. Calcutta, eine Stadt, in der alle Extreme aufeinanderprallen. Menschen werden gezeugt, geboren, leben und sterben auf dem Bürgersteig oder im Rinnstein. Die etwas Bessergestellten besitzen hundehüttengroße Verschläge aus Brettern und Pappe, mit Schlamm verputzt. Bei Regen fließt der Putz davon. Die Ärmeren kauern sich nachts in einen Hauseingang oder liegen irgendwo am Straßenrand. Sterben sie, so merkt es die Umgebung erst, wenn sich Tiere mit der Leiche beschäftigen oder Kinder darauf spielen. Dagegen liegen mitten in der Stadt feudale Rennclubs der Reichen, Golfplätze und Parks. Und doch treffen wir in dieser Stadt die freundlichsten und herzlichsten Inder. Wir sind so fasziniert von Calcutta, daß wir zwei Wochen dort bleiben.
Die Straße nach Nepal führt lange durch die Gangesebene. Dann, plötzlich und unvermittelt, taucht die Wand der Himalaya-Riesen aus dem Dunst. Das Vorgebirge steigt gleich bis auf 3000 m steil auf. Die Straße windet sich mühsam bis zur Paßhöhe, wir biegen um die letzte Kurve - und vor uns breitet sich ein Panorama von schneebedeckten Giganten aus, dessen Pracht uns schweigend staunen läßt. Zum Greifen nahe liegen die höchsten Berge der Erde vor uns. Ganz im Osten der Mount Everest, ihm folgt ein schneeweißer Gipfel nach dem anderen bis zum 8500 m hohen Anapurna-Massiv im Westen. Einsam und erstarrt zeichnen sich diese Felsmassive vor dem stahlblauen Himmelhintergrund ab; ein Bild, das sich unauslöschlich einprägt.
Kathmandu, die Hauptstadt Nepals, ist eine sympathische und sehr quirlige Stadt. Das Zentrum scheint nur aus Hindu-Tempeln, die mit schönen Holzschnitzereien verziert sind, zu bestehen. Am Stadtrand liegen die buddhistischen Stupas, auf deren Turm in jeder Himmelsrichtung ein Augenpaar gemalt ist, das den Betrachter streng und herrisch fixiert. Wir sehen auch eine leibhaftige Göttin, ein kleines Mädchen, das mit den ersten Zeichen der Pupertät gegen ein jüngeres ersetzt wird. Die Stadt wimmelt von Hippies, die dort der preiswerten Rauschgifte wegen leben.
In der Nähe von Kathmandu liegt ein Opfertempel der schwarzen Göttin Kali. Unter großer Anteilnahme westlicher Touristen finden dort zweimal wöchentlich Opferungen statt. Ein hurtiger Priester trennt den Opfertieren - vor nicht allzu langer Zeit waren es Menschen, bevorzugt Kolonialbeamte - mit einem einzigen Schnitt den Kopf ab. Ich beobachte, wie ein kopfloses Huhn auf dem Boden entlangflattert und aus Versehen einer indischen Dame unter den Sari schlüpft. Die gute Frau steht zu Stein erstarrt, während die Hühnerleiche unter ihrem Sari zuckt und ruckt. Am Ende schreitet sie wortlos davon. Wir verlassen Nepal über Pokhara. Unser nächstes Ziel heißt Benares, die heiligste Stadt der Hindus. Genauer gesagt ist dort der Ganges, noch genauer nur das linke Ufer ein kurzes Stück ganz besonders heilig. Dagegen gilt das rechte Ufer als unheilbringend, dort ist nicht eine einzige Hütte zu entdecken.
Der Hinduglauben verkündet, daß jeder, der in Benares stirbt, von der Kette der Wiedergeburten befreit wird. Reiche und Bettler suchen die Stadt zum Sterben auf. Hauptsächlich an zwei Stellen direkt am Fluß brennen die Scheiterhaufen. Für die Armen reicht meist das Holz nicht. Wir sehen, wie halbverkohlte Leichenteile in den Ganges geworfen werden, nach denen noch schnell die Krähen schnappen. Ein Hund schleppt offenbar einen Oberschenkelknochen davon.
Jeder Pilger hat rituelle Waschungen im Fluß vorzunehmen. In tiefer Überzeugung tauchen die Menschen im Wasser unter und trinken andächtig einen Schluck vom heiligen Ganges. Daß diese Leute nicht reihenweise von Seuchen dahingerafft werden - Lepra- und Pockentote z.B. werden unverbrannt dem Fluß übergeben - scheint uns unerklärlich. Später lesen wir als Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen, daß der Ganges im Laufe seiner mehrtausendjährigen Praxis hohe Selbstreinigungsmechanismen entwickelt habe.
Seit Kriegsausbruch ist die Grenze zwischen Indien und Pakistan gesperrt. In Dehli wird ein Touristen-Konvoi zusammengestellt, der angeblich am 12. März die Grenze passieren darf. Wir kommen zu spät und buchen für den nächsten Konvoi am 27. März. Bald hören wir, daß die erste Gruppe nicht die Grenze passieren durfte, sondern noch immer im Grenzgebiet feststeckt. Gerüchte jagen Gerüchte. Plötzlich taucht ein ernstzunehmendes Gerücht auf, die Grenze sei bereits am 25. März geöffnet. Zusammen mit anderen Touristen fahren wir hoffnungsvoll an die Grenze. Militär empfängt uns, kein Mensch weiß was passiert. Dann taucht ein emsiger Mann vom Verkehrsministerium auf. Nach vielem Hin und Her öffnet sich der Schlagbaum. Die Inder fertigen uns mit dem üblichen und üblich-sinnlosen bürokratischen Aufwand ab. Drei Stunden später betreten wir die pakistanische Grenzstation. In 20 Minuten haben wir alle Formalitäten erledigt - der Heimfahrt steht nichts mehr im Weg.
Nach ein paar Tagen Aufenthalt im freundlichen Kabul fahren wir zügig westwärts. In Ankara streift uns, während wir parken, ein leerer Omnibus. Bis die Polizei nach 1 1/2 Stunden eintrifft, hat der Fahrer den Bus voller Zeugen gesammelt, die alle erlebt habenwollen, daß wir den Omnibus rammten. Um wenigstens meinen Paß zurückzubekommen, muß ich vor einem Schnellrichter antreten, dort - mit geballter Faust in der Tasche - meine angebliche Schuld beschwören. Wir lassen die Tür und den Holm am Einstieg in Ankara mehr schlecht als recht für 80 DM reparieren.
Mitte April 1972 treffen wir mit gemischten Gefühlen in Deutschland ein. Spätestens am 30. September wollen wir wieder abfahren. In der Zeitung lese ich eine Stellenanzeige des Olympischen Komitees, das einen Ingenieur der Nachrichtentechnik vom 1.5. bis zum 20.9. sucht... Ich bekomme den Job, Sigrid schlüpft später auch unter die Fittiche des OK. Wir leben wie eh und je in unserem Auto, das wir auf dem Parkplatz des Organisationskomitees geparkt haben. Noch nie hatten wir so kurze Wege - sogar Fußwege - zum Büro.
Die Zeit ist angefüllt mit Hektik, Aufregungen, Spannungen. Es macht uns Spaß, weil alles unkompliziert mit viel Entscheidungsspielraum läuft. Wir erleben Atmosphäre und Tragik der Olympischen Spiele hautnah mit. Vierzehn Tage nach der Schlußveranstaltung gehen wir erneut über die Grenze Richtung Osten. Rückblickend scheint es uns, als ob wir die Reise gar nicht unterbrochen hätten. Wir hatten unkonventionelle Jobs, lebten unkonventionell und ließen unser geliebtes Auto bis auf wenige Tage nicht im Stich. Und weil wir kaum mit Ausgaben belastet waren, füllten wir unser Konto höher auf als vor der ersten Abreise.
Am 10. Oktober 1972 treffen wir wieder in Kabul ein und fühlen uns zu Hause. Am 14. Oktober findet zu Ehren des Königs - wohl zum letzten Mal, denn im kommenden Jahr wird der gute Mann abgesetzt - das Buz Kachi statt. Es ist ein wildes Reiterspiel aus alter Hunnen-Zeit. Damals kämpften zwei Reitermannschaften um den Besitz eines am Ende sicher toten Gefangenen, heute geht’s nur noch um ein totes Kalb, das in der Mitte eines riesigen Platzes liegt. Auf ein Trompetensignal hin stürmen die Reiter auf den Kadaver zu. Dort angekommen, zuckt ein Knäuel aus Pferdeleibern und Reiterrücken in einer Staubwolke hin und her. Plötzlich löst sich ein Reiter, er hält das Kalb seitlich am Pferd und reitet wie wild auf die Zuschauer los. Die ergreifen die Flucht, doch im letzten Augenblick wird der Reiter von der Horde eingeholt, einer versucht das Kalb zu entreißen, andere dreschen auf sein Pferd und ihn ein. Uns wundert’s, daß keiner die Pistole zieht und den Kalbs-Halter einfach vom Pferd schießt. Wahrscheinlich mußten die Leute vorher alle Waffen abliefern. Dieses wahrlich rauhe Spiel währt solange, bis es einem Reiter gelingt, das Kalb in einen Kreis vor der Königsloge zu werfen. In der Endphase verschwinden die Logen im Staub, Fahnenmasten stürzen um, Zuschauer gehen selbst auf den Logendächern in Deckung, dann plötzlich erlösende Stille: das Kalb liegt im Kreis. Die nächsten Mannschaften treten an.
Einen Tag später fahren wir auf abenteuerlichen Staubstraßen hinauf in den Hindukusch nach Bamyan. Riesige Buddha-Statuen kündigen in diesem wild-romantischen Hochtal vom längst vergessenen Glauben. Etwa 80 km entfernt liegen die Seen von Bandi-Amir. Der gleichnamige Fluß hat sich terassenförmig gestaut und fünf Seen gebildet. Jeder See leuchtet in einer anderen Farbe: tiefblau, grün, sogar weiß, azurblau und fast schwarz. Ein fast unwirkliches Kleinod in der Abgeschiedenheit des Hindukusch.
Kurz vor dem Khyberpaß treffen wir die beiden amerikanischen Weltumwanderer wieder, denen wir vor einem Jahr in der Türkei begegneten. Am nächsten Abend schlafen die beiden neben der Straße; Afghanen wollen sie bestehlen. Die Amerikaner schießen. Daraufhin holen die Afghanen Verstärkung und Gewehre: der eine Amerikaner wird erschossen, der andere schwer verletzt. (Der wanderte später trotzdem weiter und kehrte zwei Jahre später nach Amerika zurück.)
Fast einen ganzen Tag brauchen wir für den Grenzübertritt von Pakistan nach Indien. Ein indischer Beamter kann meinen Paß nicht lesen und schreibt in sein Kontrollbuch als Vorname "Oval" und Nachname "Blau" - die Angaben unter "Gesichtsform" und "Augenfarbe" im Paß.
Gleich hinter der Grenze biegen wir nach Norden in die Berge von Kashmir ab. Das Kashmirtal ist sicherlich im Sommer sehr hübsch. Aber im November empfinden wir nur noch Kälte. Die Kashmiri schleichen mit ihrer Individual-Heizung durch die Straßen: sie tragen einen kleinen Tonkrug, in dem Holzkohle glimmt, unter einem weiten Umhang. Ein frierender Postbeamter goß zusätzlich Petroleum in seinen Ofen; er verbrannte mitsamt Postamt und Briefen.
Wir wollen den Dalai-Lama besuchen und kämpfen uns über schmale, aber hübsche Straßen am Himalaya-Rand entlang nach Dehra Dun. Dort fragen wir - und erfahren, daß der Dalai-Lama seit Jahren in Dharmsala lebt. Wir müßten weit in der Richtung, aus der wir kommen, zurückfahren; wir verzichten auf den Besuch.
Wieder besuchen wir Dehli, eine Stadt, die wir bei unseren letzten Aufenthalten sehr schätzen lernten. Wir bleiben so lange, daß wir an unserem nächsten Ziel, in Agra, in der Vollmondzeit ankommen. Wiederum gilt unser Besuch dem Taj Mahal. Dieses Bauwerk ließ ein reicher Mogul-Herrscher seiner Lieblingsfrau als Grabmal errichten. Schon bei unserem ersten Besuch zog es uns ganz in seinen Bann. Diesmal betreten wir das Eingangsgebäude im Vollmondschein. Aus dem Dämmerlicht hebt sich zuerst die weiße Hauptkuppel ab, blaßweiß, zart und empfindsam vom Mondlicht nachgezeichnet. An beiden Seiten schimmern die Seitenkuppeln in mattem Glanz, darunter, mehr als dunkler Schatten, das quadratische Basis-Gebäude. Die große Kuppel scheint über ihrem Fundament zu schweben, von den beiden Seitenkuppeln gestützt. Wir bleiben fast eine ganze Nacht und können uns nicht sattsehen. Schon bei Sonnenaufgang kehren wir zurück und erleben, wie Licht und Schatten ein ganz neues Bild zeichnen. Das Taj Mahal ist für uns das schönste Gebäude der Welt, schön und vollkommen.
Folgten wir bei der ersten Indienreise den Küsten der Halbinsel, so haben wir jetzt unsere Route quer durchs Land gelegt. Wir berühren einige Orte, die nur selten von westlichen Touristen aufgesucht werden. Hier auf dem Land, abseits der Zentren, gefallen uns die Inder, besonders die einfachen Leute. Ihre Augen strahlen vor Herzlichkeit und Wärme. Obwohl kaum jemand englisch spricht, finden wir immer wieder Kontakt. Und wenn wir heute an all die von uns bereisten Länder zurückdenken, so glauben wir, daß geradedie einfachen indischen Dorfbewohner zu den Menschen zählen, die glücklich zu sein scheinen. Glück - soweit es sich an strahlenden Augen, offenen Gesichtern und Fröhlichkeit ablesen läßt.
Wir sehen uns die ältesten Stupas Indiens in Sanchi an, besuchen die buddhistischen Höhlenklöster in Ajanta mit 1300 Jahre alten und eindrucksvollen Fresken. Nicht weit entferntliegt Ellora. Dort haben Hindu-Baumeister in fast irrwitziger Arbeit zunächst eine Höhle in einen Felshügel getrieben, deren Innenwände genau einem gemauerten Tempel entsprechen. Dann trugen sie von außen den Fels solange ab, bis nur noch Wände in üblicher Mauerstärke stehenblieben: es entstand ein Tempel aus gewachsenem Stein.
Auf dem Weg gen Süden berühren wir kleine Orte wie Daulatabad, Aurangabad, Badami und Pattakal. Unser Ziel jedoch heißt Goa, Paradies Goa. Dort angekommen, fahren wir geradewegs zu unserer Palme vom vorigen Jahr: unberührt wiegt sie sich im Wind. Nichts hat sich verändert. Wir hatten befürchtet, daß uns der zweite Besuch enttäuschen würde, aber wieder genießen wir diesen herrlichen Platz, wieder sind wir glücklich wie vor einem Jahr.
Mit einer kurzen Unterbrechung allerdings. Sigrid hatte vor der Abreise leichte Leberbeschwerden. Sie fühlt sich seit ein paar Tagen etwas schlapp und geht vorsichtshalber zum Arzt, das heißt in die ambulante Abteilung des Krankenhauses. Vor dem Sprechzimmer warten vielleicht hundert Menschen. Ein Angestellter entdeckt Sigrid am Ende der Schlange und führt sie gleich ins Sprechzimmer. Dort jedoch teilen sich vier Ärzte den einen Raum und eine einzige speckige Untersuchungspritsche. Hinter jedem Arzt drängeln sich Wartende. Jeder Inder, der wenigstens eine Aktentasche und Schuhe besitzt, geht an der geduldigen Warteschlange vorbei direkt ins Zimmer. Sigrid bittet eine Ärztin, ihre Leberfunktionen zu überprüfen. Die Ärztin steht auf, zieht Sigrids linkes Augenlid hoch und stellt die Schnelldiagnose: "Gelbsucht". Zur Untermauerung ihrer These ordnet sie noch die üblichen Laboruntersuchungen an. Die Untersuchungsergebnisse sollen drei Tage später vorliegen.
Wir fahren zurück zu unserer Palme und üben dort den Ernstfall. Sigrid bewegt sich nur zwischen Campingliege und Bett im Auto, ich koche. Pünktlich erscheinen wir im Krankenhaus. Die Leberbefunde zeigen eindeutig: alles in Ordnung.
Kurz nach Weihnachten verlassen wir voller Wehmut unser Paradies. Diesmal wissen wir nicht, wann wir wieder zurückkehren - aber daß wir es tun werden, daran zweifeln wir nicht.
Weil Burma für jeglichen Transitverkehr gesperrt ist, muß jeder Autofahrer, der von Indien aus nach Osten vordringen will, sein Auto auf’s Schiff laden. Wir suchen eine Weile in Madras nach einem billigen Frachter, buchen aber schließlich auf der regulären Linie, die zwischen Indien und Malaysia beziehungsweise Singapore verkehrt.
Uns bleiben noch 10 Tage bis zur Abfahrt. Diese Zeit nutzen wir und fahren per Eisenbahn - weil die Autoverladung zu teuer und zu kompliziert ist - nach Ceylon. Von Madras aus sind wir bis Colombo 50 Stunden unterwegs. Doch die indische Eisenbahn ist ein Erlebnis für sich. Von Station zu Station fahren Bauchladen-Händler mit, die selten mehr als 5 Flaschen Coca Cola oder ein paar Brotfladen oder Reisportionen anzubieten haben. Ein ununterbrochener Strom von Verkäufern wälzt sich durch den Zug. Weil die einzelnen Wagen keinen Verbindungsweg besitzen, springen die Leute akrobatisch- abenteuerlich während der Fahrt von einem Wagen zum anderen. Stundenlang sitzen wir bei offener Tür auf den Treppen unseres Wagens und genießen die gemütliche Fahrt durch Reisfelder, Palmenwälder und kleine Dörfer.
Sri Lanka - die englischeBezeichnung Ceylon ist verhaßt im Land - gefällt uns schon gleich nach der Ankunft. Eine wunderschöne tropische Insel mit freundlichen Menschen, einsamen Stränden und alter buddhistischer Kultur. Zum ersten Mal begegnen uns deren Mönche in ihren safrangelben Kutten, mit kahlgeschorenen Köpfen und abrasierten Augenbrauen. Stille, unaufdringliche Diener einer friedlichen Religion.
In Dambulla besuchen wir einen Höhlentempel, in dessen Dämmerlicht viele Buddhastatuen stehen. Es ist ganz still. Ein Mönch führt uns und gibt mit leiser, fast behutsamer Stimme seine Erläuterungen. An einer Stelle tropft von der Decke Wasser und er sagt, daß man dieses quellklare Trinkwasser nur den Buddhas zum Trinken darbiete. Er schweigt und wir hören in der Stille der Höhle die Tropfen fallen. Wir fahren auch auf der Insel meistens per Eisenbahn spazieren. Die Schienen führen entweder durch ausgedehnte Kokospalmenplantagen oder durch dschungelartigen Wald. Wohin das Auge schaut, immer ist alles grün. Selbst die Ruinen und Buddha- Figuren von Polonnaruwa müssen in stetem Kampf vor dem Überwuchern geschützt werden.
In Kandy dagegen wurde das zügellose Wachsen unter Kontrolle gebracht. Die Engländer schufen einen botanischen Garten, der nach unserem Eindruck einzig sein dürfte. Eine in jedem kleinsten Winkel gepflegte Anlage, deren Vielfalt an allen nur denkbaren tropischen Gewächsen und deren park- und fast gartenartige Atmosphäre uns in helle Begeisterung versetzt.
Wir fliegen zurück nach Madras. Dort laden wir zwei Tage später unser Auto aufs Schiff. Mit viel Geschrei wird der Wagen, dessen Batterie abgeklemmt sein muß, von einer vielköpfigen Mannschaft auf je ein Netz unter Vorder- und Hinterachse geschoben. Dann senkt sich der Kranhaken mit einem Gestell, in das die Netze eingehängt werden. Dann ruht der Betrieb.
Der Vormann der Schiebe- und Schrei- Mannschaft erzählt mir ausführlich, wie hart seine Männer arbeiten müssen, und wie leicht der Kranfahrer einen falschen Hebel bedienen könne, und dann würde das Auto gegen die Schiffswand geschleudert. Oder er könne beim Hinablassen in den Schiffsbauch vergessen, die Bremse zu betätigen. Ich sage dem guten Mann sehr bestimmt, daß wir bereits dem Schiffsagenten - als Bestandteil seiner Maklergebühren - ein stolzes Bakschisch für die Docker gegeben hätten. Ich weigere mich, noch einmal zu zahlen. Endlich, nach 20 Minuten, ruckt der Kran etwas unsanft an, unser Auto schwebt zwei oder drei beängstigende Minuten in der Luft, landet aber schließlich unversehrt im Schiff.
Ein paar Stunden vor Ablegen beginnt der Kampf der Inder um einen Platz an Bord. Die "Rajula", unser fast 40 Jahre altes Schiff, befördert in den ersten drei Klassen ca. 400 Passagiere, in der vierten jedoch drängeln sich 1800 Menschen. Es sind ausschließlich Inder, die in Malaysia arbeiten. Bleiben sie länger als 6 Monate außerhalb Malaysias, dann verlieren sie die Arbeitserlaubnis dort. Wer das Schiff verpaßt, hat verspielt.
Eine Tagesreise südlich von Madras ankern wir draußen vor der Küste. Das Schiff lädt einen ganzen Tag lang Zwiebeln. Lastensegler pendeln zwischen Land und Schiff. Wir beobachten voller Anerkennung, wie die schwer beladenen Boote im Wind liegen, im letzten Augenblick die Segel raffen und recht sanft an der Bordwand entlang zum Kran schleifen.
Schließlich holt auch die "Rajula" die Anker ein: Indien versinkt langsam im Meer. Wir stehen an der Reeling, wehmütig und wissend, daß uns dieses Land trotz einiger häßlicher Erlebnisse in seinen Bann geschlagen hat. Und wir spüren die Hoffnungslosigkeit, mit der Indien in die Zukunft blickt. Wie es an der jeden kleinsten Lebensbereich überwuchernden, dazu unfähigenBürokratie erstickt, Korruption auf jeder Ebene, Arroganz und Ignoranz, häufig Unfähigkeit der Führungsschicht. Dabei scheinen uns generell die Menschen aufgeweckt, freundlich und herzlich.
Eine Woche später ist Land in Sicht: die Insel Penang, die nur einen Steinwurf vom malaysischen Festland entfernt liegt. Einen halben Tag dauert die Paßabfertigung, erst am späten Abend, öffnen sich die Ladeluken; die Autos sollen entladen werden. Vor einem Jahr fiel hier der Wagen eines Freundes beim Ausladen kopfüber aus dem Kranhaken - für den Schrotthaufen sollte er zum Schluß noch Hafengebühren zahlen. Ein halbes Jahr später passierte ein ähnlicher Unfall. Wir meinen, daß die Dockarbeiter inzwischen dazugelernt haben müßten. Ich schaue mir trotzdem das Ladegeschirr an - es ist nicht zu glauben: ein Stahlseil ist bereits wiederum zur Hälfte gerissen. Sofort stellen die Leute das Ausladen ein, suchen stundenlang den Hafen nach einem Ersatzseil ab, dann baumelt unser Auto am Haken und senkt sich langsam zur Erde. Eine Beule am Radkasten bleibt als Erinnerung zurück. Ich gehe zur Verwaltung und verlange Schadenersatz. Der Hafeningenieur meint ganz trocken: "An Ihrer Stelle wäre ich froh, daß nicht mehr passiert ist. Unser Ladegeschirr ist nur für eine Tonne berechnet..." Wir jedoch brachten 2,4 Tonnen mit.
Die Insel Penang gehört zu den kleinen Paradiesen dieser Erde. Von tropischer Vegetation überwuchert, mit steilen Bergen und traumhaften, noch einsamen Sandstränden. Zum ersten Mal treffen wir auf eine starke chinesische Minderheit, die vor allem Handel und Kleingewerbe der Städte fest in der Hand hat. In Georgetown, der Hauptstadt, wimmelt es von Chinesen-Läden und Restaurants. Für ein paar Pfennige essen wir "flied lice", das soll eigentlich fried rice heißen, aber den Chinesen gelingt diese Aussprache nicht, weil ihrer Zunge ein "r" völlig fremd ist.
Eine Woche lang genießen wir Penang, dann setzen wir auf’s Festland über und verlassen ein paar Stunden später Malaysia in Richtung Thailand. Wir betreten ein Land, das nach unseren indischen Eindrücken fast unbewohnt aussieht. Die Straße führt stundenlang durch tropischen Regenwald, nur hin und wieder macht der Dschungel ein paar Feldern und luftigen Holzhäusern Platz. Diese Hütten stehen auf Stelzen, die Wände sind aus Schilfrohr-Matten geflochten, der Fußboden ist meist ein Lattengerüst. In diesem luftigen Gebilde bringt auch der schwächste Windhauch den Bewohnern Abkühlung.
In Bangkok kommen wir an einem Montagmorgen im dicksten Verkehr an. Durch Abgaswolken stehen wir uns vorwärts. Trotzdem fasziniert uns die Stadt von Anbeginn. Alle paar Minuten taucht ein buddhistischer Tempel aus dem Häusergewirr auf; bunte Pagodendächer, Windglocken, Mönche in safrangelben Kutten. Dann wieder Restaurants, kleine Märkte auf dem Bürgersteig, Chinesen-Läden.
Wir finden keinen Platz für die Nacht. Zusammen mit Berliner Reisefreunden mieten wir uns ein Hotelzimmer zum Duschen und übernachten auf dem Parkplatz des Hauses. Beim Frühstück fragt uns ein freundlicher Mensch, warum wir hier und nicht nebenan im grünen Park essen - er ist der Besitzer der zum Park gehörenden Villa und lädt uns in seinen Garten ein. Aber nicht nur in den Garten, auch zu seinen Parties und denen andrer Leute und zu Bootsfahrten auf dem Menan. Nach einer Woche voller Stadtbesichtigungen und nächtlicher Parties sind wir am Ende unserer Kräfte und flüchten an den Golf von Siam.
In dem Mode-Badeort Pattaya laden uns Touristen eines bekannten deutschen Reiseunternehmens ein, auf dem Innenhof des Hotels zu übernachten. In der lauen Tropennacht gesellen sich immer mehr Fernreisende zu uns und erzählen ihre Geschichten. Es geht natürlich nur um eine Geschichte: Sex in Thai. Von den zu allem willigen Thai-Mädchen, die fast schon zur Einrichtung der Hotelzimmer gehören - man muß sie abbestellen wie in Deutschland das Frühstück, wenn sie nicht erwünscht sind.
Morgens werden wir von Geschrei geweckt. Ein rüstiger Rentner poltert die Treppe hinunter und schwört, daß er nie wieder mit dieser Reisegesellschaft reisen werde. Ein Mädchen verabschiedete sich, als er noch erschöpft darnieder lag. Sie nahm nicht nur ihre Hand-, sondern auch seine Brieftasche mit. Diese Erfahrung kostete ihn ein paar tausend DM.
Wir fahren weiter in Richtung Laos. Ein Fährboot bringt uns über den Mekong. Drüben beginnt der Rechtsverkehr - aber nach 20 km endet jeglicher Verkehr. Die laotische Hauptstadt Vientiane liegt wie eine Insel im Pathet-Lao-Gebiet. Bei unserer Ankunft treffen wir gleich den richtigen Mann: den "Rupp vom Mekong", deutscher Schulmeister und Direktor der von der Bundesrepublik gebauten Gewerbeschule. Er lädt uns in seine Schule ein und wir verbringen einige alkoholreiche Tage und Nächte dort. Die Ausländer leben stets sprungbereit in Vientiane. Fast jeder hat ein Boot am Mekongufer liegen - die Ängstlichen mit laufendem Motor, sagen böse Zungen. Damit man bei politischer Gefahr sofort das andere Ufer, das thailändische, aufsuchen kann.
Auch die Königsstadt von Laos, Luang Prabang, liegt wie eine Insel im Pathet-Lao-Gebiet. Eine der zahlreichen Inseln, die aus der Luft versorgt werden müssen. Laotische Bauern haben daher den Reisanbau eingestellt. Laotische Kinder glauben, der Reis käme vom Himmel, weil die meisten Dörfer keinen Flugplatz besitzen und Reissäcke abgeworfen werden.
Wir fliegen mit einer uralten DC 3 nach Luang Prabang. Die erste Sitzbank, auf der wir uns im Flugzeug niederlassen wollen, kippt um. Aus dem Polster der zweiten flüchten Kakerlaken. Eine Stunde später sollen wir landen. Doch wir geraten in ein heftiges Gewitter, Sturzbäche ergießen sich in die Pilotenkanzel. Als nach ewigen Zeiten die Maschine zur Landung ansetzt, erkennen wir unter uns Vientiane, den Platz, von dem aus wir zuvor gestartet waren. Ein späterer Flug endet erfolgreich.
Alle Unbill und vermutlich auch Gefahr hat sich gelohnt: In Luang Prabang finden wir mit Abstand den schönsten buddhistischen Tempel. Als wir einen Tag später zurückfliegen, übergibt der Pilot einem Freund den Steuerknüppel und lädt uns zu einer Flasche Wein in die Kanzel. Der Mann, Franzose von Geburt, verdiente und verdient sich ein Vermögen mit Opiumflügen: von improvisierten Pisten in den Bergen fliegt er die heiße Fracht zum Golf von Siam und wirft sie zielgerecht neben Schmuggelbooten ins Meer.
Wir fahren zurück nach Thailand. In Sukhotai, der ersten Hauptstadt der Thais, erleben wir die Aufnahmezeremonie von Mönchen ins Kloster. Zwei etwa zwanzigjährige Burschen und zwei Knaben von höchstens zwölf Jahren verabschieden sich vom weltlichen Leben. Das ganze Dorf versammelt sich zu einem bunten Zug. Voran marschiert eine Musikkapelle, es folgt eine Tanzgruppe mit den schönsten Mädchen des Dorfes, dann die Novizen in weißen Gewändern und zum Schluß die Freunde und Verwandten. Vor dem Tempel gibt sich die Musik noch einmal alle Mühe, die Mädchen tanzen. Dann ein letzter Tusch. Die Novizen werfen als Symbol des Abschieds ihr letztes Geld unters Volk und schreiten würdig die Stufen zum Tempel hinauf. Der Abt - ein buddhistischer Tempel ist immer ein Kloster - erwartet sie in der Schar seiner Mönche. In langer Zeremonie bitten die Novizen um die Aufnahme. Zum Zeichen der Annahme dürfen sie ihre weißen Gewänder gegen die Mönchskutten tauschen. Und wenn sie wollen, können sie am nächsten Tag das Kloster wieder verlassen. Buddhistische Mönche gehen keine Verpflichtung ein.
Im Norden Thailands leben Bergstämme, die vor 100 und mehr Jahren aus Südchina einwanderten. In Chiang Mai betreibt ein geschäftstüchtiger Unternehmer eine Art "Zoo", in dem eilige Touristen ein paar Familien aus den Stämmen bei Arbeit und Familienleben betrachten können. Die meisten Stämme leben jedoch weit abseits und in Höhen über 1000 Meter. Bis zur Erfindung von Transistorradios versorgte sich jede Familie komplett selbst, angefangen vom täglichen Reis und Opium bis zu den bunten Trachten. Heute bauen sie Opium nicht nur für den Eigenbedarf an.
Auf hals- und achsbrecherischen Pfaden besuchen wir einige Stämme und freuen uns über die meist unkomplizierte und freundliche Begegnung mit Menschen, die auch heute noch weit entfernt von aller Zivilisation leben.
Auf Umwegen kehren wir schließlich nach Bangkok zurück. Wir bereiten eine Flugrundreise nach Japan vor und starten Mitte April. In Hongkong legen wir die erste Zwischenlandung ein. Schon beim Landeanflug dominieren zwei Eindrücke: Hochhaus neben Hochhaus und - eigentlich unerwartet - recht viel grünes Hinterland, womit sich unsere Vorstellung von einer Art Berlin schnell verwischt.
Sowohl die eigentliche Insel Hongkong als auch der Stadtteil Kowloon bieten ein dauernd wechselndes, immer geschäftiges Bild. Die Straßenfronten sind so dicht mit Reklametafeln in chinesischer Schrift behängt, daß die Hochhäuser kaum mehr zu erkennen sind. Es gibt alles und fast alles billiger als anderswo zu kaufen, rotchinesische Kaufhäuser wechseln mit Juwelierläden ab. Im Hafen von Aberdeen liegen einige tausend Dschunken dicht bei dicht, auf denen die Besitzer mit Kind und Kegel leben. Man sagt, daß einige noch niemals Festland betreten hätten.
Wir fliegen weiter nach Taiwan, das von den Portugiesen einst Ilha Formosa, "Herrliche Insel" genannt wurde. Begeistert sind wir von der Taroko-Schlucht. In den Bergen der Ostküste hat sich der Taroko-Fluß seinen Weg zum Meer regelrecht durch die Felsen gefräßt. Fast direkt zu beiden Seiten des Flußbettes wachsen die Felswände 300 m hoch senkrecht in den Himmel.
Einen ganzen Nachmittag verbringen wir in einer chinesischen Oper. Als einzige Zuschauer ohne Schlitzaugen und ohne auch nur ein Wort zu verstehen. Aber die Hingabe der Schauspieler und die Begeisterung der Zuschauer fesseln uns.
Ein paar Tage nur gönnen wir uns auf der schönen Insel, dann fliegen wir weiter nach Seoul, der Hauptstadt Südkoreas. Ganz überrascht sind wir, eine supermoderne Großstadt zu sehen mit dreistöckigen Straßenüberführungen, mit gewaltigen Hochhäusern und, wie könnte es anders sein, Verkehrsverstopfungen a la München. Sehr deutlich macht sich der japanische Einfluß allenthalben bemerkbar, sogar in den alten Palastanlagen der Stadt. Umgeben von sorgsam gehegten und gepflegten Parks strahlen die Holzbauwerke Freundlichkeit und Harmonie aus. Wir wollen aufs Land hinaus Richtung Pusan fahren, aber ununterbrochener Regen nimmt uns Sicht und Lust, enttäuscht kehren wir in die Stadt zurück und fliegen weiter nach Tokyo.
Auch Tokyo empfängt (und entläßt) uns in strömendem Regen. Das billigste noch freie Hotel kostet fast 50 DM pro Nacht. Auf dem Weg dorthin geraten wir in den Berufsverkehr. Von den Massen heimfahrender Arbeitsmenschen werden wir in eine U-Bahn geschoben, gezwängt und gepreßt. Sigrid kann nicht mehr atmen, unsere Rucksäcke gleichen Pfannkuchen. Auf dem nächsten Bahnsteig steigen wir , von Panik getrieben, aus. Trotzdem und trotz des ewigen Regens gefällt uns Tokyo sehr bald. Die Berichte und Gerüchte von der Stadt, die im Smog erstickt, von Industrie überwuchert wird und sich im Verkehrschaos entnervt, finden wir nicht bestätigt.
Wir fahren hinaus aufs Land. Über Kamakura,den Hakone-Park am Fujijama, die Perlenzüchter-Insel Toba, über Ise und Nara und Kyoto erreichen wir schließlich Hiroshima. Japan zieht uns von der Landschaft und der alten kulurellen Tradition her so an, daß wir im Zug nach Hiroshima beschließen, in Singapore unser Auto aufs Schiff nach Japan zu laden und ein paar Monate in diesem Land zu leben.
Wir kommen gegen Mittag in Hiroshima an. Zuerst buchen wir ein Hotel und fahren dann hinaus zum Friedenspark. Hier explodierte 1945 die erste Atombombe. Im Museum, das den sekundenschnellen Untergang der Stadt dokumentiert, prägt sich unauslöschlich ein Bild ein. Auf einer Treppenstufe hatte ein Mensch gesessen. Die gewaltige Hitze verdampfte ihn förmlich. Der Schatten seines Umrisses brannte sich dunkel in die Marmorstufe ein.
Tief deprimiert verlassen wir den Ort des Grauens. Schweigend fahren wir am späten Nachmittag hinaus zur Insel Miyajima. Dort steht ein Shinto-Schrein im seichten Wasser einer Bucht. Wir haben Pech, es ist Ebbe und das Bauwerk ragt auf grauen Pfählen aus dem nassen Sand. Wir schauen den trotzdem schönen Schrein an. Zum Schluß schlage ich Sigrid einen Abendspaziergang unten am Strand vor.
Ich springe vom Tempel hinunter in den Sand. Sigrid springt hinterher. Beim Aufkommen sackt ihr linker Fuß in den feuchten Sand ein, sie knickt um. Ich werde nie das laute, dumpfe Knacken vergessen, als ihr Bein bricht.
Im ersten Augenblick wollen wir die Wahrheit nicht glauben. Aber Sigrid kann nicht auftreten. Ich klettere zurück in den Tempel, frage den Priester um Hilfe. In der Nähe wohnt ein Arzt, der gerade einen Gartenstuhl anstreicht. Er fragt, ob ich Amerikaner sei. Erst als ich verneine, unterbricht er seine Arbeit und eilt mit zu Sigrid.
Sie liegt schmerzverkrümmt im feucht-kalten Sand. Der Arzt stellt den Bruch fest und bandagiert das Bein notdürftig. Er bestellt einen Krankenwagen. Zwei Männer laufen mit einer Tragbahre über den Sand. Sie heben Sigrid auf die für Japaner gebaute Liege. Obwohl wir nicht groß sind, hängen Sigrids Kopf auf der einen Seite und, schlimmer noch, die Füße auf der anderen herunter.
Die beiden Männer tragen sie hinüber zum Krankenwagen auf der Straße. Es ist ein umgebauter Personenwagen, in den sie die Tragbahre hineinschieben. Schnell wollen sie die Tür zuschlagen, Sigrid schreit, daß ihr Fuß noch draußen sei. Auch der Wagen ist zu kurz. Der Fahrersitz muß ganz weit nach vorn gestellt werden, erst dann paßt Sigrid ganz ins Auto. Eine Stunde dauert die Fahrt zurück nach Hiroshima.
Wir halten vor einem Krankenhaus, das angeblich das beste der Stadt sein soll. Sigrid wird auf einen Röntgentisch getragen. Die Aufnahme zeigt zweifelsfrei: Schienbein, Wadenbein und ein Stück vom Fußgelenk sind gebrochen. Der Arzt zeigt uns das, aber damit hört auch schon die Verständigung auf. Sigrid kommt in ein Zimmer im zweiten Stock, aber wieder wird sie von kleinen Japanern auf einer wieder zu kurzen Bahre hinauf getragen. Ein Lift existiert nicht. In dem Zimmer liegen fünf andere Frauen. Jede hat noch - es ist inzwischen 22 Uhr - Besuch. Mindestens drei Fernsehgeräte laufen. Eine Dame unterhält sich mit ihrem Papagei.
Der Arzt holt sich ein Lexikon und gibt uns zu verstehen, daß übermorgen ein Spezialist kommen und sich um das Bein kümmern werde. Damit enden seine Bemühungen. Das Bein ist weder geschient noch irgendwie fixiert. Niemand kümmert sich um Sigrid. Nach einer Weile ziehen sich die Besucher, offenbar die Ehemänner der Patientinnen aus und legen sich auf eine Reisstrohpritsche, die unter dem Patientenbett steht. Wir bemerken das mit Verwunderung, warten auch vergeblich oder zu lange auf Hilfe der Schwester.
Gegen Mitternacht fahre ich zurück ins Hotel: für eine schlaflose Nacht mit der fatalen Einsicht, daß eine winzige Fehlentscheidung, ein nur sekundenlanges Geschehen unsere gesamte Reise-Zukunft umkrempeln wird. Morgens im Krankenhaus sagt Sigrid, daß sich immer noch keine Schwester richtig um sie kümmert. Ich laufe nervös von Institution zu Institution auf der Suche nach einem englisch sprechenden Menschen. Durch Zufall werde ich mittags an ein freundliches Mädchen weitervermittelt, das fließend englisch spricht. Sie kommt mit ins Krankenhaus und klärt uns auf: es ist üblich, daß sämtliche Handreichungen von Angehörigen der Patienten erledigt werden. Schwestern sind nur für die medizinische Betreuung zuständig. Ich ziehe also wie auch die japanischen Angehörigen ins Krankenzimmer und richte mich unter dem Bett meiner Frau zwischen den beiden Rucksäcken und der Kameratasche häuslich ein.
Die freundliche Dolmetscherin sorgt auch dafür, daß der Knochenspezialist bereits am selben Tag kommt. Er untersucht das Bein und sagt, daß es in ca. 10 Tagen operiert werden müsse. Außerdem legt er einen Gipsverband an. Trotz allem finden wir nur wenig Vertrauen zu diesem Krankenhaus. Auch die hygienische Seite entspricht nicht so ganz unseren Vorstellungen. Z.B. teilt sich die gesamte Frauenabteilung fünf Bettschüsseln, um die ein steter und zäher Kampf geführt wird.
Wir telefonieren mit Deutschland und entschließen uns für Sigrids Rückflug und die Operation in München. Zwei Tage später verlassen wir das Krankenhaus. Vor uns liegt ein halber Tag Bahnfahrt nach Tokyo. Sigrid muß mit Krücken auf endlos langen Bahnsteigen humpeln. Beim Umsteigen in Okoyama müssen wir zwei Stockwerke ohne Aufzug hinauf. Sigrid kann nicht Treppen steigen. Ein Japaner holt eine Tragbahre. Vorn trägt der Japaner, ich hinten. Aber ich habe zusätzlich vorn und hinten je einen Rucksack und die Kameratasche umgeschnallt. Nach dem ersten Stock breche ich fast zusammen. Freundliche Japaner nehmen mir die Rucksäcke ab, die ihnen bis in die Kniekehlen hängen. Von Tokyo-Hauptbahnhof nehmen wir ein Taxi zum Flughafen. Dort bekommt Sigrid einen Rollstuhl. Plötzlich erscheint ein Lufthansa-Mann und sagt, er müsse Sigrid ins Flugzeug bringen.
Hastig verabschieden wir uns, eine Tür schließt sich, ich bin allein. Langsam begreife ich die Einsamkeit. Auf dem Beobachtungsdeck warte ich, bis die Lufthansa-Maschine zum Start aufgerufen wird, auf die Startbahn hinausrollt und in die Dunkelheit der Nacht davonschwebt. Mit sehr feuchten Augen gehe ich zurück, hole Rucksack und Kameratasche aus der Gepäckaufbewahrung. Ich muß in der Nacht noch mit überfüllten Bummelzügen nach Osaka fahren, von dort fliegt am nächsten Morgen meine Maschine nach Bangkok. Beim Zwischenlanden in Taipeh steigen zufällig unsere Berliner Reisefreunde ein, die vom Besuch Taiwans zurückkehren.
Sigrid und ich hatten vereinbart, daß ich in Malaysia auf ihre Rückkehr warte. In Bangkok bekomme ich einen Brief australischer Freunde, die mich einladen. Auch scheint mir die Chance, in Australien die Reisekasse aufzufüllen, günstiger zu sein. Ich beschließe, lieber nach Australien zu gehen.
Zusammen mit den Berliner Freunden fahre ich in den Süden Thailands. Aber all die zauberhaften Landschafts-Schönheiten wie Pukhet und Umgebung kann ich ohne meine Frau und wirkliche Weggefährtin - im wörtlichen Sinn - nicht genießen. Ich fühle nur zu deutlich, daß für mich das Glück, etwas Schönes zu sehen und zu erleben, im Teilen und Mitteilen liegt.
Die Freunde wollen noch in Südthailand bleiben, ich fahre allein weiter in Richtung Singapore. In Kuala Lumpur bekomme ich die erste und ersehnte Post von Sigrid. Sie ist nach knapp 24 stündigem Flug in München gelandet und ein paar Tage später operiert worden. Sie hat alles, die Flugstrapazen und die Operation gut überstanden.
An der Grenze nach Singapore sagt der Grenzbeamte, daß man mit "Autos, in denen man schlafen kann" nicht auf das Gebiet des Inselstaates einreisen darf. Es helfen keine Bestechungsversuche, ich muß zurück nach Malaysia und dort das Auto stehen lassen.
Dort haben sich bereits andere Reisende angesammelt. Wir kochen vor Wut, weil wir per Omnibus nach Singapore fahren müssen. Aber kein Protest hilft. Vielleicht finde ich deswegen nichts an dieser im Vergleich zu Hongkong farblosen Stadt. Der Inselstaat liegt wie ein flacher Pfannkuchen der malaysischen Küste vorgelagert. Malaysia dagegen gefällt mir ausgesprochen gut. Ein zentraler Bergrücken, der sich von Norden nach Süden über die ganze Halbinsel zieht, bildet das Rückgrat. Malerische und einsame Strände auf beiden Seiten der Halbinsel, freundliche und offene Menschen.
Ich buche ein Schiff nach Australien. Am Tag der Verladung darf ich nach Singapore einreisen. Ein Beamter steigt an der Grenze zu und soll mich auf dem kürzesten Weg in den Hafen dirigieren. Gegen ein kleines Bakschisch entwickelt sich der Mann zum eifrigen Helfer bei allen Besorgungen, die ich noch zu erledigen habe. Auf den direkten Weg zum Hafen legt er jetzt keinen Wert mehr.
Spät am Abend legt die "Malaysya" ab und schlängelt sich um die vielen kleinen Inseln herum ins offene Meer. Sehr zum Ärger einiger älterer Damen gibt es nur eine Klasse an Bord: die allabendlichen Parties und etwas verkrampften Gesellschaftsspiele gehen uns Autofahrern - drei andere Wagen sind noch an Bord - auf die Nerven. Bald empfängt uns auch der rauhe Indische Ozean mit schlechtem Wetter. Das Schiff schaukelt, jeder kämpft allein für sich gegen Gott Neptuns Forderungen.
Erst bei der Einfahrt in den Hafen von Freemantle beruhigt sich das Schiff - aber noch tagelang scheint die australische Erde unter meinen Füßen zu schwanken. Der erste Eindruck vom fünften Kontinent: Sauberkeit, Ordnung und Ruhe. Nach dem langen Aufenthalt in Asien fällt mir dieses etwas sehr sterile Leben besonders deutlich auf. Auch geht mir die Sterilität der Australier gleich nach der Ankunft ins Geld. Das Auto muß dampfgereinigt werden, damit keine auf der Insel unerwünschten Bakterien einreisen. Für die Vernichtungsaktion zahle ich über hundert DM.
In Perth, der Hauptstadt Westaustraliens, lebe ich zwei Wochen bei Freunden. Bei einem Ausflug nach Süden fällt das Auto plötzlich in der Geschwindigkeit ab, ich schalte zurück, da rumpelt es furchtbar und der Motor rührt sich nicht mehr. Ich versuche zu starten, aber der Anlasser bewegt den Motor überhaupt nicht. Das ist mir Gewißheit genug: der Motor ist kaputt. Der Kilometerzähler zeigt 81 032 km.
Ich halte einen Wagen an, der mich zum 10 km entfernten Städtchen Busselton mitnimmt. An einer Tankstelle baumelt das VW-Schild im Wind. Der Besitzer hängt unser trauriges Auto - zum einzigen Mal auf der ganzen Reise - an den Abschlepphaken. Wir bauen den Motor aus und entdecken im Innern nur noch wüste Eisenteile. Der Ventilkopf vom Auslaßventil des dritten Zylinders war bei 80 km/h abgerissen, hatte den Kolben durchlöchert und den Zylinder gespalten. Die Eisensplitter hatten auch die drei anderen Zylinder weitgehend zerstört.
Die kleine Werkstatt bestellt beim Großhändler in Perth einen sogenannten Rumpfmotor, für den ich gut das Doppelte vom deutschen Preis bezahle. Jedoch ein paar Tage späterverlasse ich Perth, um durch die Halbwüste des Nullabor Plains nach Sydney zu fahren. Dort liegen die Tankstellen hunderte von Kilometern entfernt,VW- Werkstätten vielleicht 1000 km und mehr. Während ich allein im Regen und auf Schlammpisten durch die Einsamkeit fahre, male ich mir des öfteren einen Motorschaden in dieser Gegend aus...
Die geographische Gestalt Australiens läßt sich am besten mit einem Teller vergleichen: an den Seiten gewölbt, in der Mitte flach. Von Perth nach Sydney bin ich 9 Tage unterwegs; vom ersten bis zum achten Tag ändert sich der Landschaftscharakter nicht: von morgens bis abends brettflaches Land. Erst am letzten Tag fahre ich über den etwa 1000 m hohen Gebirgszug der Blue Mountains an der Ostküste, und mit Begeisterung genieße ich das Kurvenfahren.
Ich habe noch eine knappe Woche in Sydney auf Sigrids Rückkehr zu warten. Ich zähle Minuten und fast schon Sekunden bis dahin. Lange vor der Ankunft der Maschine stehe ich auf dem Flughafen. Dann endlich, mit einer Stunde Verspätung, schwebt der Lufthansa-Vogel ein. Die Zollabfertigung findet hinter verschlossenen Türen statt, draußen quetschen sich die Wartenden. Endlich entdecke ich Sigrid am anderen Ende der Halle, sicher renne ich ein paar Leute auf dem Weg zu ihr um. Wir fallen uns in die Arme - nach 77 unglücklichen Tagen sind wir endlich wieder vereint.
So lange Sigrid noch nicht gehen darf, mieten wir ein möbiliertes Zimmer in der Nähe der Universität. Vier Wochen später, nach den ersten erfolgreichen Gehversuchen, brechen wir zu einer Rundreise ins nördliche Australien auf. Ursprünglich wollten wir bis nach Cairns ganz im Norden fahren, geben aber unsere Pläne unterwegs auf, weil sich auch hier die Landschaft immer gleicht. In dieser Zeit beginnt unsere Enttäuschung über Australien langsam zu wachsen. Wir vermissen die Abwechslung und auch die Herausforderung fremder Kulturen. Hier fällt alles im täglichen Einerlei zusammen: der Landschaftscharakter ändert sich nicht, die Australier pendeln zwischen Arbeitsplatz und Fernsehgerät. Nachts, ja bereits am frühen Abend, sind die Straßen selbst in Sydney wie ausgestorben.
In Rockhampton kehren wir um. Wir fahren nach Lightning Ridge. Dort graben ein paar tausend Leute nach Opalen, und das "Goldgräberfieber" der Pioniere liegt tatsächlich über dem Städtchen. Es gibt kein anderes Thema als Opal und Geschichten über Leute, die über Nacht steinreich wurden. Jeder kann sich für ein paar Dollar Gebühren einen Claim abstecken und ein Loch bis zur etwa 10 m tief liegenden, opalführenden Schicht graben. Die meisten tödlichen Unfälle in Lightning Ridge passieren, weil betrunkene Opal-Sucher in diese Löcher fallen und sich das Genick brechen.
Wir suchen ein paar Tage lang, vergeblich natürlich, in aufgelassenen Claims nach übersehenen Steinen und fahren dann zurück nach Sydney. Wir hatten für Anfang Dezember ein Schiff für die Überfahrt nach Südamerika gebucht. Die zwei Monate bis dahin wollen - vielmehr müssen - wir arbeiten, unserer Reisekasse zuliebe.
Ich finde sofort einen Job als Ingenieur, Sigrid beschäftigt sich mit Büroarbeit, weil sie für eine Fotografen-Arbeit noch zuviele Schwierigkeiten mit ihrem Bein hat. Unsere Firma möchte, daß ich mich für Jahre verpflichte. Selbstverständlich will sie bei der Wohnungssuche behilflich sein. Wir aber wollen weder so lange bleiben, noch in eine Wohnung einziehen. So spielen wir ein ärgerliches Spiel. Vom Campingplatz fahren wir auf Umwegen in die Firma, damit niemand sieht, wo wir herkommen. Und wenn es, was sehr häufig passiert, eine Woche lang ununterbrochen regnet, kriecht der Schimmel an den Schuhen hoch, die Kleidung ist feucht und klamm. Sigrid muß manchmal kurz vor derAbfahrt meine Hose bügeln - australische Campingplätze bieten alle Stromanschluß - und ich ziehe sie erst auf dem Firmenparkplatz an.
Die Wochenenden verbringen wir meist in der Stadt. Wir haben einige Deutsche und Österreicher kennengelernt, vor deren Häusern wir häufig übernachten (wir schlafen grundsätzlich immer in unserem Auto). Aber unser Lieblingsplatz im Stadtzentrum liegt im alten Botanischen Garten: wenn wir morgens aufwachen, fällt der erste Blick auf das Opernhaus in Sydney. Von diesem Gebäude sind wir fast genauso begeistert wie vom Taj Mahal in Agra. Die "weißen Betonsegel" an der Hafeneinfahrt von Sydney stellen für uns ein einsames Meisterwerk moderner Architektur dar, gewagt und sicher genial mit den überhängenden Muschelschalen.
Der arabisch-israelische Krieg bricht aus. Seine Folgen treffen uns gleich: die einzige Schiffahrtslinie, die zwischen Australien und der Westküste Südamerikas operiert, stellt zunächst den Verkehr ein. Dann nimmt sie zwar den Dienst wieder auf, aber die Abfahrt verzögert sich von Woche zu Woche. Ursprünglich wollten wir Weihnachten bereits in Peru feiern, wir sitzen aber noch bis zum 15. Januar in Australien. Dann endlich können wir unser Auto im Hafen abliefern. Es wird erst einige Tage später verladen.
Wir fahren per Omnibus nach Brisbane. Dort steigen wir auf ein anderes Schiff, die "Columbus Australia", - als Deckarbeiter. Der Kapitän hat uns den Job und eine gut eingerichtete Kammer, wie die Seeleute sagen, angeboten. Die "Columbus Australia" läuft nur zwischen Australien, Neuseeland und den USA hin und her, sie gehört einer deutschen Reederei und transportiert hauptsächlich Kühlcontainer.
Wir heuern abends an, nachts läuft das Schiff aus und am nächsten Morgen dürfen wir zum Arbeiten antreten. Das Schiff schlingert und rollt gegen Windstärke 8 an, wir sind seekrank wie noch nie. Der Bootsmann, unser Boß, hat kein Mitleid. "Das ist ganz einfach: kotzen und arbeiten". Wir lassen unsere Kammertür weit offen, damit’s nicht auf den frischgereinigten Flur geht. Erst kurz vor der Ankunft in Neuseeland beruhigt sich das Meer.
In Wellington mieten wir uns zusammen mit ein paar Seeleuten ein Auto und fahren quer durch die Nordinsel nach Auckland. Nach den 6 Monaten australischer Einheitslandschaft brechen wir in Begeisterung aus. Herrliche, erfrischende Landschaft, irgendwo an das dünnbesiedelte Mitteleuropa vor hundert Jahren erinnernd. Glasklare Flüsse und Seen, aus denen man noch trinken kann. Aktive Vulkane und sprudelnde Geysire sorgen für zusätzliche Abwechslung. Wir verlassen Neuseeland mit der Erkenntnis, ein noch sehr unberührtes Land, das alle klimatischen und auch zivilisatorische Ansprüche für Mitteleuropäer erfüllt, gesehen zu haben.
Es folgen 16 lange und harte Tage "Robben". So nennen die Seeleute unseren Job, für den wir nur in Naturalien bezahlt werden: freie Überfahrt und freies Leben an Bord. In Auckland sind noch zwei amerikanische Robber zugestiegen und wir klagen uns täglich unser täglich Leid. Die beiden allerdings wurden den Ölfüßen, den Männern im Maschinenraum, zugeteilt. Dort herrschen Temperaturen von 40 Grad, und die amerikanischen Kollegen dürfen Heißwasserleitungen entrosten. Ich werde schließlich auch zu den Ölfüßen versetzt, dort aber dem Blitz - dem Bordelektriker - zugeteilt. Sigrid flickt derweil mit der einzigen Nadel und dem einzigen (weißen) Faden an Bord blaue Arbeitsanzüge der Matrosen.
Von unseren professionellen Seefahrerkollegen sind wir ziemlich enttäuscht. Eigentlich hatten wir Leute mit Freude am Reisen erwartet. Aber die Männer kennen kaum mehr als drei oder vier Bars in den Hafenstädten der Erde. Einzige Gesprächsthemen sind Frauen und Saufen. Es vergeht kaum ein Abend ohne ein Zechgelage, bei dem im Laufe der Zeit mehr als die halbe Heuer draufgeht. Interessant ist uns lediglich der Kapitän, ein richtiger alter Haudegen, von allen Wassern der Erde gewaschen. Seinen Seefahrergeschichten hören wir mit Begeisterung zu.
Endlich erreichen wir Panama. Während die "Columbus Australia" in den Kanal einläuft, steigen wir auf eine Barkasse um, die uns an Land bringt: wir betreten amerikanischen Boden. Von Balboa, dem Hafen der Kanalzone, bringt uns ein kleiner Omnibus nach Panama City. Der fröhliche Neger am Steuer spielt Rennfahrer. Er geht in die Kurven, daß der Holzaufbau ächzt und knirscht, die Fensterglasscheiben klirren, selbst das bunte Marien-Porträt über seinem Kopf zu zittern beginnt. Heiße lateinamerikanische Rhythmen aus dem Radio stacheln den Fahrer zu tollkühnen Überholmannövern an. Wir strahlen vor Freude: endlich wieder Leben, endlich Neues, Unbekanntes, Unerwartetes.
Wir bleiben nur einen Tag im teuren Panama und fliegen weiter nach Guayaquil in Ecuador. Wir wollen die Galapagos-Inseln besuchen. Vor 2 Jahren fuhren Freunde für 10 Dollar pro Person hinüber. Wir wandern drei Tage lang von Schiffs- zu Schiffsagentur und finden kein Angebot unter 170 Dollar. Außerdem ist für die nächsten zwei Wochen alles ausgebucht, dann aber soll unser Auto bereits in Peru ankommen. Schweren Herzens verzichten wir.
Mit einer Maschine der Ecuatorian Airlines wollen wir nach Lima weiterfliegen. Die Maschine wird einen halben Tag lang repariert. Bei der Paßabfertigung gesteht uns eine Amerikanerin, daß sie für diesen Flug wegen der langen Reparatur mit ihrem Leben abgeschlossen habe. Tatsächlich fliegen außer der Amerikanerin und uns nur noch zwei Nonnen mit. Vor dem Start gießt der Pilot schnell Öl in die Turbopropmotoren.
Weil uns stets von Raubüberfällen in Südamerika erzählt wurde, haben wir unser Geld in die Schuhe gesteckt. Das erweist sich als fatal. In der Tropenhitze wanderten wir stundenlang, jeder auf 500 Dollar pro Fuß. Derartigen Beanspruchungen jedoch scheinen Dollarnoten nicht gewachsen. Im Flugzeug ziehe ich eine Note aus dem Schuh: sie ist buchstäblich abgelaufen. Alle vier Ecken sind ausgefranst, die Farbe total verwaschen. Den anderen drei Noten, die zu oberst in den anderen Schuhen lagen, ist es nicht anders ergangen. Derartige Scheine dürften auf keinem Schwarzmarkt mehr umzutauschen sein.
In Lima erfahren wir zu unserer Bestürzung von der Schiffsagentur, daß das Schiff mit unserem Auto wegen Treibstoffersparnis und Hafenstreik in Australien erst zwei bis drei Wochen später ankommen wird. Wir suchen uns das billigste Hotel zum Warten. Es liegt in der Hauptgeschäftsstraße, eine schmale Gasse, durch die auspufflose Motorräder donnern oder noch lautere Omnibusse. Einige Zimmernachbarn dämmern im Haschischrausch dahin, andere können wir nach einem Geld-Schwarzmarkthändler ausfragen. Der Mann mit dem günstigsten Kurs betreibt einen kleinen Souvenirladen.
Beim ersten Besuch ist der Herr mißtrauisch. Er lotst mich in die eine Ecke seines Ladens. Dort steht ein riesiger Bauernschrank. Er öffnet eine Tür und bittet mich hinein: drinnen handeln wir den Kurs aus, jeder prüft die Scheine des anderen auf Echtheit. Dann verlassen wir den Schrank und tun sehr gleichgültig. Später kennen wir uns so gut, daß das Geschäft direkt über den Ladentisch geht. Beim letzten Wechseln fällt mir der Abschied von dem vorsichtigen Mann tatsächlich schwer.
In Australien hatten wir eine Peruanerin kennengelernt, die uns bei ihren Eltern anmeldete. Die Eltern wiederum bieten uns ein Zimmer im Haus von Verwandten an. Dort, in einem Einfamilienhaus am Stadtrand, lebt Berta, eine freundliche und attraktive Witwe zusammen mit ihrem Bruder Julio. Wir nehmen die Einladung gern an. Bertha und Julio sprechen nicht englisch. Wir büffeln, während wir insgesamt vier Wochen auf unser Auto warten, mit den beiden freundlichen Menschen spanisch.
Am ersten Wochenende fahren wir nach Huancayo, einem kleinen Städtchen in den Anden. Dort strömen am Sonntag die Indios der Umgebung zu einem farbenprächtigen Markt zusammen. Wir müssen die Eisenbahn nehmen, die auf dieser Strecke den höchsten Eisenbahnpaß der Erde in 4800 m Höhe zu überqueren hat, und sie startet in Meereshöhe. Vier Stunden lang keucht die Lokomotive mal ziehend, mal schiebend den Berg hinauf. Ein Mann, der allgemein als Doktor angesprochen wird, fährt in jedem Zug mit und teilt aus einem großen Gummisack Sauerstoff an Notleidende aus. Wir meinen, daß uns die Höhe überhaupt nichts ausmacht. Auf jeder Station springen wir hinaus, um zu fotografieren oder uns umzuschauen. Schon als der Zug die Paßhöhe überquert, fühle ich mich unwohl. Später nach der Ankunft im nur 3200 m hoch gelegenen Huancayo, schwanke ich ins erstbeste Hotel, mein Magen dreht sich um, und ich falle wie ein Stein ins Bett. Gegen Mitternacht habe ich mich erholt - doch jetzt baut Sigrid ab. Übelkeit, Atemnot und Herzbeschwerden beunruhigen uns. Wir nehmen ein Taxi ins Krankenhaus. Der diensthabende Sanitäter holt mürrisch eine Sauerstofflasche herbei, Sigrid muß sich in ein schmuddeliges Bett legen, der Sanitäter gibt ihr die Sauerstoffmaske und eine Spritze. Dann legt er sich schlafen. Es ist kalt im Krankenhaus, wir frieren. Auf der Suche nach einer Wärmequelle finde ich schließlich eine elektrische Kochplatte, die ich unter Sigrids Bett zum Heizen aufstelle. Gegen Morgen hat auch Sigrid sich erholt.
Der Indiomarkt hält tatsächlich alle Versprechungen. Handgeknüpfte Teppiche, Ponchos, bunte Borten und Keramiken. Die Stände brechen fast zusammen. Auch die Preise liegen trotz der hin und wieder auftauchenden Touristen im günstigen Bereich. Am nächsten Morgen gehen wir zum Bahnhof, setzen uns in den Zug und warten auf die Abfahrt. Nach einer Stunde spricht sich herum, daß ein Erdrutsch letzte Nacht die Gleise verschüttet habe. Vielleicht können wir am nächsten Tag fahren.
Erwartungsvoll wandern wir einen Tag später erneut zum Bahnhof. Doch diesmal dampft und raucht immerhin eine Lokomotive. Wir suchen uns einen Platz, bald rumpeltder Zug los. Kaum haben wir die Stadt verlassen, bricht eine alte Dame in helle Aufregung aus: ihre Handtasche mit allem Geld und allen Dokumenten ist gestohlen. Bald läßt sich das Geschehen rekonstruieren. Zwei junge Burschen nutzten den Moment der Abfahrt, griffen blitzschnell die Handtasche und verschwanden aus dem Zug. Ein Amerikaner zeigt uns den Schnitt im Rücken seines Anoraks. Als er gestern morgen vor dem Fahrkartenschalter wartete, schnitt ein Dieb eine Öffnung in Anorak, Hemd und Unterhemd, zerschnitt den Tragriemen seines umgehängten Brust-Geldbeutels und zog ihn heraus, ohne daß es der Besitzer gleich bemerkt hatte.
Ein deutscher Lehrer, der in Kolumbien lebt, erzählt, daß er eines Tages von einem Lastwagen ziemlich langsam überholt wurde. Beim nächsten Halt schaut er seinen Dachgepäckträger an, jedoch der ist völlig leer. Während des Überholens hatten die Diebe kurzerhand vom Dach seines Autos in das ihre umgeladen. Ein Schweizer zeigt die Narbe am Unterarm, die ihm als einziges bei einem Überfall in Acapulco blieb: die Räuber schnitten das Armband seiner Uhr ein bißchen zu fest durch. Wir können nur die Geschichte Berthas in die allgemeine Aufregung des Abteils flechten: bei einem Sonntagsnachmittagsspaziergang mit ihren beiden Freundinnen in Lima springen drei Männer plötzlich von Motorrädern, entreißen den Damen Handtaschen und Schmuck. Eine der Freundinnen trägt Ohrringe, die sich in der Eile nicht öffnen lassen. Der Räuber wählt die schnellste Lösung, er schneidet die Ohrläppchen mitsamt der Ringe ab. Wir kaufen uns in Lima, bevor wir uns auf den Heimweg durch finstere Gassen machen, eine Fahrradkette als Waffe und schnallen die Kameratasche mit einem zweiten Riemen am Gürtel fest.
Bis zur Ankunft unseres Autos vergehen vier Wochen. Um die Zollabfertigung im Hafen zu erledigen, muß ich in elf verschiedenen Büros Unterschriften unter einem Berg von Papieren sammeln. Normalerweise brauchen die Agenten zwei Tage für die Prozedur. Weil ich Zeit habe, trainiere ich das Wettrennen vor der Ankunft und kann den zermürbenden Papierkrieg in einem halben Tag erledigen.
Wir sind glücklich, daß unser Auto gut gelandet ist, und wir endlich wieder in unseren eigenen vier Wänden wohnen und auf dem eigenen Herd kochen können. Nach ein paar Tagen verlassen wir Lima und fahren gen Süden. Bis kurz vor Santiago de Chile zieht sich der Wüstenstreifen, der zwischen Küste und Anden-Region liegt und von zahlreichen Oasen unterbrochen wird. Über 3000 km Fahrt durch Wüstenlandschaften. Ein Erlebnis, das uns immer wieder in seinen Bann zieht.
An der chilenischen Grenze beginnt der Ärger mit dem Militär - und dem Gemüse. Die Einfuhr von Obst und Gemüse ist verboten. Wir haben aber gerade das Auto vollgeladen mit Feldfrüchten. Der Grenzbeamte herrscht uns an, daß das Gemüse zu vernichten sei. Sigrid erwidert, daß sie es stattdessen vor seinen Augen für’s Mittagessen kocht. Der Mann nickt unwirsch und weicht nicht vom Kochtopf. Plötzlich verschwindet er unmotiviert. Sigrid nutzt den Augenblick, um alles was sie nicht kochen kann, in den Schlafsäcken und sonstwo zu verstecken (nach 14 Tagen findet sie einen verfaulten Apfel tief im Kleiderschrank). Anschließend lassen wir uns zum Essen nieder, mit vollem Bauch und rohem Gemüse im Schlafsack reisen wir ein.
Wir schauen uns ein bißchen im Grenzstädtchen Arica um, das einen sauberen Eindruck macht. Sigrid kauft die neue Gemüsevorräte wegen der vor uns liegenden langen Fahrt. Wir fahren weiter. Nach allerhöchstens zwei Stunden taucht plötzlich in einem menschenleeren Wüstental ein Schlagbaum auf - Militärkontrolle und Gemüsekontrolle. Junge Soldaten durchwühlen gerade einen Omnibus mit penetranter Pingeligkeit. Sigrid nutzt die eineinhalbstündige Wartezeit und versteckt erneut alles Gemüse.
Ein paar Tage später überrascht uns mitten im Land die dritte Gemüsekontrolle, diesmal aber so unverhofft, daß wir bereits vormittags um 9.30 Uhr Mittagessen kochen müssen. Irgendwo verstehen wir natürlich, daß die Chilenen Gemüse- oder Fruchtkrankheiten nicht quer durchs Land schleppen lassen wollen.
Santiago de Chile ist eine gepflegte Stadt mit vielen Grünanlagen; sie macht einen wesentlich saubereren und auch liebenswürdigeren Eindruck als Lima. Der blutige Allende-Umsturz ist inzwischen aus dem öffentlichen Bild soweit wegretuschiert, daß die Außenmauern des Regierungspalastes keine Spuren mehr zeigen.
Südlich von Santiago fahren wir direkt in den beginnenden Winter. Schon von Ferne sehen wir die schwarze Wolkenwand uns entgegenziehen: Schnee- und Regenschauer hüllen uns ein. Das haben wir den Arabern mit ihrem Ölembargo zu verdanken. Ohne sie wären wir Weihnachten mitsamt Auto in Peru angekommen und hätten problemlos mindestens noch den Lago Argentina - eins der angeblich größten Naturwunder Südamerikas - erreicht. Jetzt ist das fast unmöglich.
Wir hören von den Chilenen, daß Aussicht auf Wetterbesserung erst in Wochen bestünde. Daher biegen wir kurz hinter Temucco nach Osten ab und überqueren in der Nähe von Villarica die Anden. Eine Schotterstraße schlängelt sich durch ein wunderschönes, wildromantisches Tal. Die Paßhöhe ist bei 1200 m erreicht und wir betreten Argentinien in einem großen Naturschutzpark. Aber es regnet auch auf dieser Seite der Anden. Als wir im ersten Ort tanken und beim Bezinpreis von fast 1 DM/Liter halbswegs in Ohnmacht fallen, erzählt der Tankwart, daß am Vortag der Preis um 120 % angehoben wurde. Vor Schreck fahren wir auf dem kürzesten - aber immer noch 2000 km langen - Weg direkt nach Buenos Aires. Bei den ewig schnurgeraden, immer langweiligen Straßen durch die argentinische Pampa beschließe ich endgültig, Handgas ins Auto zu bauen. Anschließend kann ich beide Füße auf die Armaturentafel legen und gemütlich am Steuer dösen. Was bei deutschen Verkehrsverhältnissen ganz undenkbar wäre.
In Buenos Aires fühlen wir uns wohl. Die Stadt ist eine freche Mischung aus Rom, Paris, Wien und Berlin. Es gibt unzählige Kaffeehäuser und vor allem auch Menschen, die nichts anderes lieber mögen als Kaffeehäuser. Die Argentinier - im übrigen eine eigene Mischung aus Italienern, Spaniern und Mitteleuropäern - leben erst abends richtig auf. Ab 21 Uhr erreicht die Jagd nach freien Restaurant- und Kaffeehausstühlen ihren Höhepunkt. In der Gegend der geschmackvollen Florida, der Haupteinkaufsstraße, herrscht dann größeres Gedränge als am Tag.
Der Rotary-Club in einem hübschen Vorort, dem Tigre-Delta, lädt uns zum Abendessen ein. Wir kommen schon nachmittags, parken das Auto im Schatten des hauseigenen Parks und machen eine Bootsrundfahrt. Gegen 19 Uhr klopft der Hausmeister und Koch ans Auto, druckst eine Weile herum und meint dann, wir könnten nicht in Jeans zum Essen erscheinen. Wir beruhigen ihn. Zehn Minuten später klopft er erneut. Wir müßten uns doch sicher waschen, ob wir nicht in sein Bad kommen wollten. Wieder beruhigen wir ihn und führen unser fließendes Wasser vor. Als wir dann frisch gewaschen und gesellschaftsfähig herausgeputzt zum Abendessen erscheinen, vom Präsidenten auf den Ehrenplatz gesetzt werden, da ist dem Hausmeister sein Fragen so unangenehm, daß er uns zum Abschied eine Flasche Sekt überreicht.
Das Fährschiff über den Rio de la Plata startet früh am Morgen. Wir übernachten der Einfachheit halber auf dem Parkplatz vor der Bootseinfahrt. Kaum stecken wir morgens den Kopf aus dem Fenster, spricht uns Herr Fischer aus Wien an. Er ist vor dem zweiten Weltkrieg nach Argentinien geflohen und betreibt eine Textilfabrik. Auf dem Schiff unterhalten wir uns; die Überfahrt über das breite Mündungsbecken des Rio de la Plata dauert ein paar Stunden. Herr Fischer lädt uns nach Punta del Este ein, einem kleinen Badeort am Südostzipfel von Uruguay.
Wir besuchen zunächst Montevideo. Selbst die Hauptstadt von Uruguay - das einstmals die Schweiz Südamerikas genannt wurde - verfällt. Wir sehen eingestürzte Hauswände und Bauruinen, die verrotten.
Durch eine hübsche Hügellandschaft fahren wir nach Punta del Este. Dort trauen wir unseren Augen nicht. Reiche und Superreiche aus den umliegenden Ländern haben sich hier Villen, manchmal fast Schlösser gebaut. Die Architekten konnten sich bedenkenlos austoben und schufen Bauten in jedem nur denkbaren Stil. Aber alle respektierten den natürlichen Baumbestand und versteckten ihre Phantasiegebilde meist hinter Wald und Hecken. Natürlich entstand auch viel Komisches und Kitsch.
Bald fahren wir weiter nach Brasilien. Brasilianisch, das heißt portugiesisch klingt uns wie russisch in den Ohren. Allerdings leben gerade hier im Süden des Landes viele Deutsche. Und als wir abends auf einer Hazienda fragen, ob wir auf der Wiese übernachten dürfen, spricht man deutsch. Auf dem Weg nach Norden folgen wir der Atlantik-Küste. Bald ändert sich die Vegetation in tropischen Regenwald. Wir übernachten an einsamen Stränden, von niemandem gestört.
Auf der Strecke von Curitiba nach Sao Paulo lernen wir die ununterbrochenen Lastwagenkolonnen kennen, die den größten Teil des brasilianischen Güterverkehrs bewältigen. Ohrenbetäubender Lärm der schweren, möglichst schalldämpferlosen Wagen, blaue Abgaswolken, riskante Überholmannöver. Kurz vor Sao Paulo machen wir abseits der Straße Mittagsrast. Ein furchtbar emsiger Mann kommt und erzählt, er sei Reporter. Wir wollen unsere Ruhe und beachten ihn kaum, er fotografiert unentwegt und stellt uns Fragen, die wir nur unwillig beantworten.
Die Groß- und Weltstadt Sao Paulo beeindruckt uns gewaltig. Ein Wolkenkratzer steht neben dem anderen, aber wiederum nicht so dichtgedrängt, daß man sich verloren fühlt. Auch hier spürt man die gestalterische Freiheit der Architekten, die einige wirklich elegante Hochbauten geschaffen haben. Von einem Aussichtsrestaurant schauen wir allerdings auch direkt in die schwarzen Fensterhöhlen eines ein paar Monate zuvor ausgebrannten Hochhauses, aus dessen obersten Stockwerken Menschen vom Feuer getrieben in den Tod sprangen. Sao Paulo wird, wie auch die anderen brasilianischen Großstädte, von einem autobahnähnlichen Straßensystem durchzogen. Wenn es überhaupt Straßenschilder gibt, dann sind sie so winzig, daß man sie kaum lesen, geschweige denn rechtzeitig erkennen kann. Wir verfahren uns dauernd, und zum ersten und einzigen Mal geht mir das Fahren so auf die Nerven, daß ich froh bin, als wir die Stadt verlassen.
Von Sao Paulo nach Rio de Janeiro führt eine Autobahn und die zwei Spuren in beiden Richtung sind mit Lastwagen angefüllt. Wir kommen vormittags in Rio an. Am deutschen Konsulat holen wir unsere Post ab; lesen Briefe und essen am Strand mit Blick auf den Zuckerhut zu Mittag. Bereits dieser erste Eindruck von der phantastischen Lage der Stadt fesselt uns. Als wir ein paar Tage später auf den Corcovado, den gut 700m hohen Berg mit der Christusstatue, hinauffahren und sich die Stadt mit ihren vielen Buchten und Badestränden zu unseren Füßen ausbreitet, erklären wir Rio von der Lage her zur schönsten der uns bekannten Städte. Der Ausblick aus dieser Höhe auf das Häusermeer läßt uns nicht los. Wir übernachten auf dem Corcovado und können vom Bett aus hinunterschauen auf den Lichterglanz der nächtlichen Stadt.
Wir bleiben viel länger als wir planten in Rio. Endlich brechen wir auf nach Brasilia. Die Hauptstadt liegt gute 1300 km nordwestlich, halbwegs in der Steppe. Voller Spannung auf die weltbekannte und - kritisierte Konzeption erreichen wir die Stadt - und verlassen sie einen Tag später wieder, enttäuscht. Vielleicht gewinnt Brasilia in einigen Jahren oder Jahrzehnten an Reiz, wenn ein paar grüne Bäume gewachsen sind, und auch die Menschen die Leere verdrängen.
Wir fahren noch einmal nach Sao Paulo. Weil uns in Rio ein Tankwart mit der Hebebühne die Motoraufhängung beschädigte, suchen wir das VW-Werk auf. Auch verliert der relativ neue Motor Öl. Aus Kulanz bietet man uns nach einigem Verhandeln an, daß wir den Arbeitslohn tragen und VW das Material. Als wir abends bezahlen wollen, entläßt man uns mit den besten Empfehlungen und lehnt zu unserem Erstaunen jede Berechnung ab. Während Sigrid in einem Supermarkt einkauft, spricht mich ein Brasilianer im Auto an und fragt, ob ich nicht für ihn den Toto-Zettel ausfüllen wolle. Ich frage: "Warum?" "Sie sind doch ein Glücksvogel, das steht doch hier in der Zeitung!" antwortet er und zeigt mir die heutige Zeitung, in der ein halbseitiger Bericht jenes emsigen Mannes steht, der uns vor ein paar Wochen die Mittagsruhe raubte. Jetzt meinen wir auch das Entgegenkommen von VW zu verstehen.
Als nächstes Ziel steuern wir die Iguazu-Wasserfälle an. Sie liegen an einem Dreiländereck aus Brasilien, Argentinien und Paraguay. Bei unserer Ankunft geht die Sonne über den Fällen unter. Sie taucht die Wasserschleier, die als Gischt versprüht aus der Tiefe aufsteigen, in purpurrotes Licht. Dahinter die schwarzdunkle Wand des Dschungels. Ein überwältigendes und unvergeßliches Erlebnis. Und eines der großen Naturschauspiele: über eine sichelförmige Kante von 2,5 km Länge stürzt der Fluß in die Tiefe.
Um von Brasilien ins Nachbarland Bolivien zu kommen, müssen wir wegen nicht vorhandener oder überschwemmter Straßen durch Paraguay und Nordargentinien fahren. Zwar hätten wir uns das eigentlich gemütliche, von Herrn Stroessner streng regierte Land sowieso angesehen, aber der Umweg durch Nordargentinien kostet uns 2500 km.
Dort, ein Stück hinter Salta, beginnt die Straße stetig zu steigen. Nach einer Tagesreise haben wir uns in 3500 m Höhe der Anden- Gebirgswelt hinaufgeschraubt, eine Höhe, auf der wir uns viele Wochen weiterbewegen werden.Aber auch an ein zweites Kriterium der künftigen Verhältnisse gewöhnen wir uns: nicht asphaltierte Straßen oder gar pistenartige Strecken. In Bolivien hört dann jeder Verkehr fast auf. An einem Tag treffen wir nur 4 Lastwagen, müssen aber zweiundfünzig Mal Flüsse und Bäche durchqueren. Streckenweise gehen Weg und Flußbett ineinander über. Solange der Fluß halbwegs ausgetrocknet ist, läßt sich gegen diese doppelte Nutzung nicht viel sagen. In der Regenzeit jedoch fällt jeder Autoverkehr aus.
Über Potosi, das einst zu den reichsten Städten zählte, weil es an einem halbwegs aus Silber bestehenden Berg gebaut war, fahren wir nach La Paz. Die Hauptstadt von Bolivien liegt in einer Talsenke, aber 4000 m über dem Meeresspiegel. Steile Straßen führen von der Hochebene hinunter in die Stadt. Ich habe Angst, ob wir jemals wieder hinauf kommen, weil dem Motor in dieser Höhe gute 40 % Leistung fehlen. Wir starten spät abends zu einer Probefahrt, und tatsächlich, mit der letzten Kraft schaffen wir es. La Paz gehört zu den ärmsten Hauptstädten Lateinamerikas. Es scheint uns, als ob ganze Stadtviertel nur Marktviertel sind, wo die Indios ein paar Tomaten oder eine Handvoll Kartoffeln zum Kauf anbieten, und auf den Käufer müssen sie vielleicht einen ganzen Tag lang warten.
Wir fahren weiter zum Titicaca-See. Es ist der größte See in dieser Höhe, uns kommt er schon wie ein Meer vor. In Puno mieten wir ein Boot und fahren hinaus. Der See liegt bewegungslos wie Blei, im sauberen Wasser sehen wir Fische flüchten, die Luft in dieser Höhe ist ganz klar, kein Dunstschleier trübt den Blick auf die schneebedeckten Berge in der Ferne. Wirbesuchen die Urdu-Indianer, die im kilometerbreiten Schilfgürtel des Sees leben. Sie reißen das Schilf aus, werfen soviel davon ins Wasser, daß tragfähige Inseln entstehen, auf denen sie ihre Hütten bauen, Schilfhütten natürlich. Wenn sie Hunger haben, essen sie - die Wurzeln vom Schilf oder sie fahren in Schilfbooten hinaus zum Fischen. Viele der zumeist gichtigen Leute betreten nie oder nur ungern Festland, weil sie auf hartem Boden nicht gehen können.
Unser nächstes Ziel ist die ehemalige Hauptstadt des Inka-Reiches, Cusco. Von dort lenkten einstmals die Inka-Herrscher ein Imperium, dessen gewaltige Ausdehnung vom heutigen Kolumbien bis südlich von Santiago de Chile alle bis dahin bekannten Staatengebilde übertraf. Eine Handvoll Spanier unter dem Kommando von Pizarro kam, sah und siegte. Mit List und Heimtücke metzelten sie die Führungsschicht nieder, schafften die unermeßlichen Goldschätze nach Spanien und zerstörten die Hauptstadt Cusco. Auf den Grundmauern bauten sie Kirchen und Klöster.
Nur diese Mauern und eine halbzerstörte Festung zeugen heute von der kaum vorstellbaren handwerklichen Geschicklichkeit der Inka- Baumeister. Sie fügten die Steine so nahtlos dicht und ohne Mörtel oder Zement aneinander, daß diese Gemäuer allen Erdbeben widerstanden. Auch heute läßt sich nicht einmal eine Rasierklinge in die Fuge zwischen zwei Steinen schieben. Und das selbst bei über zwei Meter hohen und viele Tonnen schweren Blöcken.
Ein einziges, festungsartiges Dorf entging der Zerstörungswut der Spanier. Es lag so abseits, daß es erst 1911 wiederentdeckt wurde: Machu-Picchu, einer der Höhepunkte jeder Südamerika-Reise. Auch heute noch führt nur eine Eisenbahn bis in die Nähe der Festung. Dort, am Urubamba-Fluß, steigen wir aus und in einen Omnibus um, der uns in wilder Serpentinenfahrt 600 m den Berg hinauf vor die Tore von Machu Picchu bringt. Das ehemalige Wehrdorf klebt auf dem Verbindungsrücken zweier Berge. Tief unten schäumt in einer Haarnadelkurve der Urubamba um diese Festung. Dahinter, durch den Fluß getrennt, steigen dichtgrüne Berge empor, die von schneebedeckten Riesen in der Ferne noch einmal überragt werden. Diese unglaublich schöne Lage inmitten einsamer Anden-Welt ist das eigentliche Erlebnis Machu Picchu, daran können wir uns nicht sattsehen. Das Wehrdorfselbst mit dicken Mauern, Sonnentempel, einem kleinen Palast für den Herrscher, strohgedeckten Bauernhäusern und terassenförmig angelegten Feldern paßt sich in diese Landschaft so völlig ein. Es gewinnt erst durch sie seinen eigenartigen Reiz.
Ursprünglich planten wir, quer durch die Anden über Ayacucho und Huancayo zurück nach Lima zu fahren. Aber heftige Regenfälle hatten eine Brücke weggespült, ein Erdrutsch staute einen Fluß zu einem See, in dem die Straße verschwand. Um nicht hunderte von Kilometern auf Schotterstraßen zurückzufahren, wählen wir eine Querverbindung zur Küste bei Nasca. Noch bevor wir die Westbarriere der Anden überqueren, treffen wir amerikanische Reisekollegen, die mit einem ausgebauten Lastwagen und einem schwer beladenen, LKW-großen Jeep gerade dorther kommen, wohin wir wollen. Sie sind seit fünf Tagen auf der 300 km langen Strecke unterwegs, blieben viele Male stecken, kippten zweimal fast um. Der eine der Männer hält sich mit letzter Kraft aufrecht, am liebsten möchte er auf der Stelle nach Hause fliegen.
Gemeinsam mit einem englischen VW-Bus-Paar, mit dem wir seit La Paz zusammen reisen, machen wir uns trotz aller Warnungen auf den Weg. Im Hochtal vor dem ersten Paß legen wir einen Tag Pause ein, schauen die Autos durch, backen Kuchen auf Vorrat und tanken genügend Wasser (und Benzin natürlich). Frühmorgens brechen wir auf. Der schmale Weg klettert von 3200 m weitere 1000 m hinauf, häufig müssen wir um kleinere und größere Erdrutsche herumbalanzieren. Wir folgen einer Hochebene mit einsamen Indio- Dörfern, vor denen Lamas und Alpacas weiden. Schneebedeckte, majestätische Gipfel liegen zum Greifen nahe, wir fühlen die Herausforderung der Einsamkeit und der unbarmherzigen Umgebung in dieser Höhe. Aber trotz aller düsteren Vorhersagen kommen wir gut voran. Unsere Autos sind schmal und leicht genug, um zwischen den tiefen Gräben der Lastwagenräder gerade noch genug Halt zu finden. Mit Schwung und angehaltenem Atem fahren wir durch Schlammstrecken, ein paar Mal holpern und schaukeln wir im Fußgängertempo über puren Fels. Aber wir bleiben nicht ein einziges Mal stecken. In einem geschützten Tal übernachten wir und treffen am nächsten Mittag in Nasca ein. Dreieinhalb Tage früher als die Lastwagenbesitzer.
Wir hörten, daß man in der Nähe von Nasca auf einem Gräberfeld aus der Inkazeit nach Tonkrügen und alten Sachen graben könne. Einen halben Tag lang suchen wir den Rand der Wüste nach diesem Feld ab, kurz vor Sonnenuntergang biegen wir um einen Hügel. Ein sportplatzgroßes Feld ist übersät mit ausgebleichten Totenschädeln, mit Gerippen und Stoffetzen. Wir übernachten in der Nähe und machen uns am nächsten Vormittag an die archäologische Arbeit. In der Gruft einer hockend beerdigten Inka-Dame finden wir einen schönen bemalten Tonkrug, der gute 500 Jahre alt sein dürfte. Unsere englischen Freunde sind ähnlich erfolgreich. Den Peruanern gegenüber haben wir kein schlechtes Gewissen; in der Nähe von Lima gibt es ein ähnliches, aber weit größeres Feld, in dem professionelle Schatzgräber (und Fälscher) Touristen bedienen.
Jetzt, im Juni, liegt der Küstenstreifen von Peru und Chile unter einer ständigen, deprimierenden Nebeldecke. Nichts erscheint uns trostloser als Nebel über der Wüste, der Sand verliert alle Farbe, er wirkt feucht und grau wie die Farbe der Nebeldecke. Wir sind froh, daß wir diese Gegend während der schönen Jahreszeit erlebt haben.
Über Lima fahren wir, der Küste folgend, nach Norden. Einmal verlassen wir noch die gut ausgebaute Asphaltstraße und mühen uns über ausgefahrene Wege hinauf in die Berge, in die Umgebung von Huaraz. Dort rücken die westliche und die östliche Andenkette immer enger zusammen, bis sie sich in der Schlucht des Santa-Flusses fast berühren. Im Abstand von nur 15 m steigen sie fast parallel und wohl 1000 m senkrecht in die Höhe, ein fast beängstigender Anblick.
Diese Gegend gehört zu erdbebenreichen Gebieten der Erde. 1970 löste ein Erdbeben eine Gletscherwand, die Geröll mit sich reißend zu Tal stürzte. An einer engen Stelle des Tals schwappte sie über eine Hügelkette und begrub innerhalb von wenigen Augenblicken ein ganzes Städtchen, an einem Sonntagnachmittag als gerade ein Fest stattfand. Wir wandern über diese Geröllhalde. Der Kirchturm liegt 50 Meter neben dem Platz, wo einst die Kirche stand, vom zentralen Dorfplatz blieben noch vier einsame Palmen übrig, ein VW-Käfer ist zu einem handlichen Paket zusammengefaltet; auch heute noch ein grauenhaftes Bild des Schreckens.
Wir fahren weiter nach Ecuador, das Land auf dem Äquator. Die flachen Küstengebiete kommen uns wie eine einzige, ununterbrochene Bananenplantage vor. Im Andengebiet dagegen, auf Höhen um 3000 m, weiden Kühe auf saftigen Wiesen, fühlen wir uns in mitteleuropäische Regionen versetzt. In Quito, der hübschen und hoch gelegenen Hauptstadt, wird es nachts richtig frisch - nur 15 km südlich des Äquators. Genauer gesagt, 15 km vom alten Äquator entfernt. Nachmessungen um 1960 ergaben, daß der echte Äquator gute 100 km weiter nördlich liegt.
Über Otavalo, einem Städtchen mit einem sehr malerischen Samstagsmarkt fahren wir zur kolumbianischen Grenze. Die Ecuatorianer haben sich plötzlich etwas ganz Neues ausgedacht. Sie verlangen eine Art Ausreisezoll für’s Auto. Wir wollen die 50 DM nicht zahlen und fahren in einem günstigen Augenblick unbemerkt hinüber auf die kolumbianische Seite. Nach der Grenzabfertigung sind wir noch keine zwei Minuten unterwegs, als plötzlich ein dicker Baumstamm quer über der Straße liegt. Männer mit Eisenstangen in der Hand stoppen uns. Einer bückt sich und will die Luft aus dem Reifen lassen. Wütend springe ich aus dem Auto. Der Mann läßt zwar ab vom Rad, aber die anderen kreisen mich drohend ein.
Jonathan, unser englischer Freund, springt ebenfalls aus seinem Wagen und beruhigt erstmal die Leute und mich. Dann erfahren wir, daß gestern die Benzinpreise um 40 %, von 10 Pfg auf 14 Pfg pro Liter erhöht wurden. Die Lastwagenfahrer haben daraufhin Streik ausgerufen und blockieren mit Gewalt jeglichen Verkehr. So schnell wir können kehren wir um und flüchten vor den aufgebrachten Leuten zurück in die Grenzstation. Dort sitzen wir zwei Tage lang fest; des nicht gezahlten Zolls wegen können wir nichteinmal ins grenznahe Städtchen nach Ecuador zum Einkaufen.
Als endlich der Streik beendet ist, hält uns nach einer halben Tagesfahrt ein Polizeiposten auf: Die Straße sei 24 Stunden lang gesperrt. Über einen Bach war eine neue Brücke gebaut worden. Mit dem Abriß der alten hatte man gerade begonnen, ohne daß die neue befahrbar ist. Bagger schütten erst einen Straßendamm dorthin auf. Zum zweiten Mal sitzen wir ungewollt fest. Aber nach diesem etwas mißlichen Beginn ändert sich bald unser Kolumbien-Eindruck. Besonders die Landschaft genießen wir. Die Berge liegen unterhalb der Schneegrenze, sie sind überzogen mit saftig grünen Teppichen aus Buschwerk oder Gras oder Wäldern oder Kaffeeplantagen. Die Straße führt unentwegt bergauf und bergrunter. Die Kolumbianer lieben Blumen, ihre meist sehr fröhlich angepinselten Häuser schwimmen regelrecht in Blumengärten. Häufig sind sogar Haus- und Blumenfarbe aufeinander abgestimmt.
Kolumbien gilt als das gefährlichste Land Südamerikas, in Bezug auf Räuber und Diebe. Wir sind besonders vorsichtig, fahren immer im Konvoi zusammen mit unseren englischen Freunden und suchen uns für die Nacht Schutz auf Haziendas, bewachten Hotelparkplätzen und in der Hauptstadt Bogota auf dem Parkplatz des Goethe-Instituts. In Bogota verzichten wir auch auf den Besuch des Monserrate-Berges, von dem man einen guten Blick auf die Stadt haben soll. Die Zufahrtsstraße steht angeblich unter der Kontrolle professioneller Räuber. Vor einem Jahr bezahlte ein Deutscher für diese Erkenntnis 20 000 DM; die Räuber blockierten die Straße, der Arme mußte sein Geldversteck im Auto herzeigen und dann die Reise abbrechen.
Berühmt ist das Goldmuseum in Bogota. Es birgt wohl den größten Teil der wiedergefundenen Goldschmiedearbeiten aus der Inka-Epoche. Die wertvollsten Funde sind in einem Raum konzentriert. Der Wärter läßt die Besucher immer erst in den voll verdunkelten Raum treten, dann dreht er langsam die Beleuchtung auf. Die mit Gold bedeckten Wände und Vitrinen beginnen leicht zu glimmen, leuchten mehr und mehr und erstrahlen dann im vollen, tatsächlich blendenden Glanz.
Zwischen Kolumbien und Panama, also zwischen Süd- und Nordamerika, gibt es keine Straßenverbindung. Kenner der Situation rechnen mit vielen Jahren bis zur Fertigstellung einer seit vielen Jahren geplanten Straße: für die paar hundert fehlenden Kilometer Straße muß man leider irgendeine andere Transportmöglichkeit suchen. Auf dem Weg von Bogota nach Carthagena erkundigen wir uns in Medellin bei einer Frachtfluggesellschaft, die auch Autos nach Panama transportiert. Aber der Preis liegt ein paar hundert DM über den Schiffskosten.
In Carthagena, einem sehr alten spanischen Hafen mit hübschem Altstadtkern, kommen wir an einem Sonntag an. Zufällig treffen wir einen Amerikaner, dem wir bereits mehrere Male unterwegs begegneten. Er hat für Montag ein Schiff gebucht; das nächste kommt erst drei Wochen später. Wir wollten eigentlich nur buchen und, wenn wir noch Zeit hätten, für eine Woche nach Venezuela fahren. Aber am Montagmorgen stellt sich heraus,daß wir abends noch mitfahren können. So steigen wir zu und zahlen für die nur 17 Stunden dauernde Überfahrt 1118 DM. Jeder von uns betrachtet diesen Preis als eine moderne Art von Seeräuberei. Aber das ist noch die billigste Überfahrt, die wir überhaupt ausfindig machen können...
In Panama liegt die ganze Kette der kleinen mittelamerikanischen Staaten vor uns. Das wäre sehr interessant, wenn nicht der Ärger an jeder einzelnen Grenze wäre. Bevor er abgeklungen ist, hat man bereits die nächste Grenze mit dem nächsten arroganten, korrupten und schikanösen Beamten erreicht. Die Herren versuchen, für jeden Handschlag Geld zu verlangen, und außerhalb der Bürozeit Überstundengeld. Mit Lust ziehen sie die Abfertigung so hinaus, daß sie in die lange Siesta der Mittagszeit oder den Feierabend fällt. In Nicaragua telefoniert der einzige Paßbeamte 20 Minuten mit seiner Frau. Um 12 Uhr legt er den Hörer auf, schaut auf die Uhr und verlangt von mir 2,50 Dollar für die 10 Sekunden dauernde Unterschrift. Er weiß ganz genau, daß wir, wenn wir bis zum Ende seiner Pause um 14 Uhr warten, eine weitere Stunde in Honduras verlieren, weil sich die Nachbarn eine Sommerzeit leistenund es dort dann erst 13 Uhr ist.Wütend gehe ich zum Vorstand der Station. Und nur, weil der gerade einen Diplomaten bedient, erläßt er mir gnädig den Überstundenzoll.
Von der Landschaft her gefallen uns die mittelamerikanischen Staaten - bis auf Honduras, von dem wir wenig sahen - sehr gut. Costa Rica ist ein schönes, gepflegtes Ländchen, in dem sehr viele Mitteleuropäer, besonders Deutsche, leben. Auch Nicaragua mit seinem großen, von Vulkanen gesäumten See, macht einen sehr abwechslungsreichen Eindruck. In der Hauptstadt Managua suchen wir vergeblich das Zentrum. Ein Erdbeben ebnete die Stadt am 24.12.72 nahezu völlig ein, die Trümmer der niedrigen Häuser sind bereits von Gras und Gebüsch überwuchert, an einigen Hochhausruinen arbeiten Räumkommandos, Trümmerfrauen suchen Ziegelsteine und Alteisen aus dem Schutt.
Guatemala gefällt uns gut. Die Hauptstadt Guatemala City kommt uns recht gemütlich, mit dem spanischen Sinn für Siesta vor. Sie liegt in ewigem Sommerklima in den Bergen, von dort lassen sich die karibische Küste im Osten oder der Pazifik im Westen leicht erreichen. Die Menschen in Guatemala sind freundlich und aufgeschlossen. In Chichicastenango besuchen wir einen Indianermarkt, der vor zwei Kirchen stattfindet. Die Indianer gehen immer mal schnell in eine der Kirchen und murmeln ein paar Gebete; daß zumeist die alten Indianer-Götter gemeint sind, scheint die katholische Kirche zu tolerieren. Wir besuchen den Atitlan-See. Er liegt eingebettet zwischen hochaufragenden Vulkanen; malerischer könnte es gar nicht sein. An seinem unverdorbenen, glasklaren Wasser legen wir Rast ein und beneiden die Menschen, die dort leben.
Von Guatemala City fahren wir der karibischen Küste entgegen, aus der angenehmen Höhenluft hinunter in die tropische Schwüle. Wir besuchen die Maya-Ruinen von Tikal, die pyramidenförmig und hoch aus dem Urwald ragen. Der Weg dorthin ist in den Dschungel gehackt, streckenweise so eng, daß er mehr einem Tunnel gleicht. Von Tikal führt der Schlammpfad weiter nach Britisch Honduras oder Belice, wie sich der winzige Staat nach seiner vollständigen Unabhängigkeit nennen möchte. Auf ausgefahrenen Asphaltstraßen durchqueren wir das absolut flache Land und betreten Mexico auf der Halbinsel Yucatan.
Yucatan besteht aus weißem Kalkfels, dessen Oberfläche abgeflacht und von Dschungel oder dichtem Busch überwuchert ist. Der südöstlichen Küste sind lange Korallenriffe vorgelagert, die das Meeraquarium klar filtern. Durchsichtige Wellen rollen sanft auf schneeweißem Sand aus. Das Bild übertrifft jede kitschig-bunte Postkarte. In diesem warmen Wasser zu baden und zu tauchen, das müssen wir einfach ein paar Tage lang tun. Zusammen mit unseren englischen Freunden suchen wir uns schattige Palmen am Strand für die Badepause. Keine 10 Tage nach unserer Abreise wird die Gegend von einem Wirbelsturm verwüstet.
Wir besichtigen die Maya-Ruinen von Chichen-Itza, Uxmal, Kabah und Palenque - und sind ein bißchen enttäuscht. Im Gegensatz zu den eleganten, manchmal fast verwundbar zarten Bauwerken vieler asiatischer Kulturen wirken die Ruinen hier meist grobschlächtig und plump. Vielleicht stört uns auch der Gedanke an die vielen Menschenopfer. Besonders ernüchternd - und erschauernd - betrachten wir daher die Ruinen der Azteken um Mexico-City. Dort brachten es die Priester fertig, an hohen Opfertagen bis zu 10 000 Menschen abzuschlachten, ihnen das Herz aus der Brust zu reißen und es, zuckend noch, als Opfer darzubieten.
Mexico City ist sicher die schillernste Stadt Lateinamerikas, mit absolut eigenem Gesicht. Spanische Kolonialbauten, riesige Wandgemälde oder Mosaiken oder auch einfach naive Malerei auf dem nackten Beton moderner Hochhäuser, winklige Gassen und die 10 Fahrbahnen breite Prachtstraße Reforma wetteifern um die Gunst der mexikanischen Seele. Oder zum Beispiel die Musikergruppen, die sich am Garibaldi-Platz versammeln und für ein paar Pesos jedes beliebige Stück aufspielen - da singt jeder mit, keiner geht vorbei. Uns gefällt die Stadt so gut, daß wir am liebsten gleich dort bleiben möchten für ein paar Jahre...
Nur ungern verlassen wir Mexico-City, aber wir wollenweiter, damit wir nicht in den Winter Nordamerikas geraten. Auf der mexikanischen Hochebene kommen wir zügig voran und betreten in El Paso die Vereinigten Staaten. Auf dieses Land sind wir sehr gespannt und in unseren Voraus-Gefühlen gespalten. Wir schleppen all die Vorurteile mit, die besonders in Mitteleuropa gepflegt werden. Aber auf dem Weg über Arizona hinauf zum Monument Valley, zum Glen Canyon und dann zum Grand Canyon, begreifen wir erst richtig, welch’ phantastische landschaftliche Schönheiten die USA besitzen.
Das Erlebnis Grand Canyon zählt noch einmal zu den großen Höhepunkten unserer Reise. Vor Jahrmillionen floß der Colorado River durch eine flache Hochebene. Im Laufe der Zeit trug er die Erde davon und grub sich eine immer tiefere Rinne. Heutzutage schäumt der Fluß am Grunde eines 1000 Meter tiefen Grabens, dessen unbewachsene nackte Steilhänge ziegelrot schimmern und mit weißen, schwarzen, violetten oder senffarbenen Streifen oder Punkten durchsetzt sind. Für den Geologen Abbild der Erdgeschichte, für uns ein gewaltiges, in seiner Pracht und Größe überwältigendes Gemälde der Natur.
Über Las Vegas, das Death Valley und den landschaftlich schönen Yosemite Park fahren wir, mit einem Abstecher nach Monterrey, nach San Franzisco. Von der Stadt, die landschaftlich prächtig an der großen Bucht liegt, hatten wir viel erwartet. Wir stellten uns eine Art großes Künstlerviertel mit buntem Leben vor. Aber trotz intensiver Suche finden wir nur eine Kleinausgabe und verlassen ein wenig enttäuscht die Stadt.
Auf dem Weg nach Salt Lake City und weiter zum Yellowstone Park freuen wir uns an einer in allen Farben schwelgenden Herbstlandschaft. Der Yellowstone Park empfängt uns mit eisiger Kälte und Schneeschauern. Aber die folgenden Tage sind klar und wir erleben die landschaftliche Schönheit dieses riesigen Gebietes in all ihrer Vielfalt: die Geysire, die phantastischen Gebilde der Kalk- und Mineralablagerungen, den Yellowstone Canyon und den großen stillen See des Yellowstone River. Aber neben all der großartigen Landschaft imponiert uns, daß die Amerikaner bereits im vorigen Jahrhundert dieses Gebiet zum Nationalpark erklärten und damit schützten. Zu einer Zeit, als bei uns kein Mensch auf solche Ideen kam. Und auch heute noch pflegen sie ihre Parks mit einer Sorgfalt, die Bewunderung verlangt.
Für die Weiterreise nach Norden, nach Kanada, hat uns die strenge Kälte jede Lust genommen. Wir biegen nach Osten ab und fahren über Mount Rushmore und die Badlands nach Washington. Dort legen wir eine lange Pause bei Freunden ein und reparieren endlich auch die Federung hinten rechts am Auto, die kurz vor dem Yellowstone Park laut krachend gebrochen war. Über 3000 km legten wir mit dem hinkenden Wagen zurück.
Die letzte Etappe führt von Washington nach New York. Von der Verrazano-Brücke - eine der mächtigsten Hängebrücken der Welt - sehen wir zum ersten Mal dieses Betongebirge vor uns liegen. Vorn an der Spitze der Insel Manhattan überragen 120 Stockwerke hohe Türme des World Trade Center all die "Kleinen" mit nur 80 oder 90 Stock. Auch als wir später von der 110 Stockwerke hohen Spitze des Empire State Building hinunterschauen, scheint es uns kaum glaubhaft, daß Menschen zu einer derart geballten Bauleistung fähig sind wie Manhattan sie darstellt. Uns gefällt New York, wir finden kaum eins der vielen negativen Urteile bestätigt. Im Gegenteil, für uns ist diese Stadt die attraktivste der USA mit ihren zahllosen Bühnen, Kinos, Kneipen, Konzertsälen und Museen. Allen Warnungen zum Trotz übernachten wir 10 Nächte lang wie üblich im Auto, irgendwo auf einer etwas stillen Straße in Manhattan. Kein Mensch überfällt oder belästigt uns.
Für die Überfahrt nach Deutschland haben wir als billigste Linie die Atlantic Container Lines herausgefunden. Zu unserem großen Ärger müssen wir das Auto völlig ausgeräumt auf dem Schiff abliefern, das heißt, nur die fest eingebaute Einrichtung darf im Wagen bleiben. Trotzdem füllen wir alle Hohlräume wie Lüftungsschächte mit Büchern und anderen Utensilien auf. Außerdem scheinen uns einige Fächer im Auto immer noch sicherer zu sein als die Kartons, in die wir den Inhalt des Autos umfüllen müssen. Wir verstecken dort alle Wertsachen wie Tonbandgeräte und Radio und alle Souvenirs.
Das Schiff soll an einem Mittwoch New York verlassen, wegen eines halben Feiertages müssen wir das Auto bereits am Montagnachmittag abliefern. Am Mittwoch fahre ich noch einmal zum Hafen, um nachzuschauen, ob alles klappt. Auf dem riesigen Parkplatz darf ich nur mit einem Angestellten der Reederei zum Wagen gehen. Und dort sehe ich die Katastrophe: ein Dieb hat die stabile Verbindungstür im Durchgang zwischen Fahrerhaus und Wohnabteil aufgebrochen und alles durchwühlt.
Ich bin sprachlos vor Schrecken; noch dazu kann ich in Anwesenheit des Angestellten nicht nachschauen, ob der Dieb unsere Verstecke ausgeräumt hat. Maßlos ärgert mich, daß sich die Reederei auf meine Vorwürfe hin nicht einmal äußert. Es kommt mir vor, daß Diebe und Räuber zumindest toleriert, wenn nicht gar als Arbeiter dort beschäftigt werden. (Bis zum heutigen Tag, an dem ich diese Zeilen schreibe, haben wir mindestens sechs andere Touristen getroffen, die mit dieser Linie verschifften. Jeder wurde schamlos bestohlen).
Deprimiert gehe ich zum Telefon und erzähle Sigrid von dem Unglück. Sie hat kurz zuvor einen Anruf einer Firma entgegengenommen, bei der ich mich vorgestellt und wegen einer Beschäftigung im Ausland nachgefragt hatte. Diese Firma braucht ganz dringend einen Mann meiner Ausbildung für wenigstens eine Woche in Teheran. Ob ich nicht aushelfen könne. Ich rufe an und sage zu. Vierundzwanzig Stunden später soll ich abfliegen.
Ich trage Jeans und Pullover. Alles andere ist verpackt und nach Deutschland unterwegs. Wir müssen Anzug, Hemden und Krawatten kaufen, weil ich in München nur einen kurzen Zwischenaufenthalt habe. Abends fliegen wir vom Kennedy Airport ab. Beim Zwischenaufenthalt in München besorge ich mir schnell ein paar Fachbücher. Sigrid bleibt zurück und geht zwei Tage später ins Krankenhaus, um unser letztes Reise-Souvenir bergen zu lassen: acht Stahlschrauben, mit denen ihr gebrochenes Bein zusammengeschraubt war.
Ich arbeite eine hektische Woche lang in Teheran. Dann fliege ich zurück nach Deutschland und hole in Bremerhaven unser Auto ab. Voller Spannung untersuche ich die Verstecke: die Diebe waren zu dumm zum Stehlen, nichts von den Wertsachen ist verschwunden. Da steht nun unser braves und tapferes Auto wieder auf deutschem Boden - und darf nicht fahren. Um Versicherung (die ja nur innerhalb Europas gilt) und Steuern zu sparen, hatten wir bei der Ausreise aus Europa den Wagen abgemeldet und waren mit unzugelassenem und zumeist unversichertem Auto einmal um die Erde gefahren. Nicht ein einziges Mal gerieten wir deswegen in Schwierigkeiten. Jetzt aber muß ich mir rote Nummernschilder besorgen, um nach München fahren zu können. Dort folgt die umständliche und teure Prozedur der Wiederzulassung.
Über München hängt grauer Novemberregen. Wir können uns nicht einfinden in die alte Umwelt, tagelang sitzen wir wie gelähmt, voller Trauer und Depression tatenlos herum. Daß dieses ganze Erlebnis der Vergangenheit angehören soll, dieser bitteren Erkenntnis fügen wir uns nur sehr schwer.
Und doch bereuen wir nicht einen Augenblick, auf die lange Reise gegangen zu sein. Es war eine Zeit, in der wir extrem bewußt lebten - an jeden einzelnen Tag können wir uns erinnern -, wir haben Alternativen zu unserer mitteleuropäischen Kultur und zu unseren Lebensgewohnheiten verstehen gelernt. Wir haben wenigstens einen kleinen Teil der Erde mit eigenen Augen gesehen, haben Sonne und Wind mit unserer Haut gefühlt, die fremde Wirklichkeit mit allen Sinnen eingefangen.
Jedoch, die Unruhe in uns lebt weiter, Zwar ist der größte Hunger gestillt - aber satt geworden sind wir nicht.
Mit diesen Sätzen endete unsere Reise-Geschichte, die wir unter dem Titel AUTO-WELTREISE Anfang 1975 publiziert hatten. Inzwischen - im Jahr 1977 - gibt es noch ein paar Geschichten nachzutragen.
Damals, 1975, hatte ich eine Stelle in meinem Beruf gefunden, und wir mieteten uns eine kleine Wohnung im Olympischen Dorf in München. Wir versuchten, uns an den Alltag zu gewöhnen und die Härten der Rückgliederung ins normale Leben erträglich zu gestalten. Unsere Träume jedoch gehörten einer anderen Welt.
Kein Wunder, daß wir die erste Chance spontan ergriffen, die sich plötzlich und unerwartet bot: wir kamen von einem Pfingstausflug nach Hause zurück und fanden ein Telegramm im Briefkasten. Ich las es zweimal, bis ich die Tragweite des Inhalts begriff. Die Internationale Fernmelde-Union (eine Unterorganisation der UNO), bei der ich mich Ende 1974 beworben hatte, bot mir eine Stelle als "training expert" an einem College in Pakistan an. Als wichtigste Bedingung wurde genannt, daß ich in den nächsten Wochen bereits anfangen müsse.
Fieberhaft blätterten wir im Kalender und stellten fest, daß ich meine Stelle in München am nächsten Tag noch kündigen könne,andernfalls müßte ich ein weiteres Vierteljahr warten. Zur Entscheidung blieb uns nicht mal eine Nacht.
Wir schoben alle Bedenken beiseite. Vor allem sahen wir zwei Chancen: einmal würden wir Zeit und Gelegenheit finden, ein fremdes Volk viel intensiver kennenzulernen als es jemals einem Reisenden möglich ist. Zum anderen würden wir aktiv in der Entwicklungshilfe arbeiten können. Außerdem wäre Pakistan von der Lage her gar kein schlechter Platz, sowohl Afghanistan als auch Indien liegen vor der Haustür.
Auch das Städtchen Haripur, in dem wir wohnen würden, liegt recht günstig im Norden des Landes, nicht allzu weit von der Regierungshauptstadt Islamabad entfernt. Von unserer Reise her konnten wir uns sehr gut an die Gegend erinnern, zumal wir im naheliegenden Taxila übernachtet und in Islamabad ein paar Tage zugebracht hatten. Das alles sah sehr positiv aus.Nach wenigen Stunden hatten wir den Entschluß gefaßt und am nächsten Morgen kündigte ich meine Stelle. Sigrid begann mit dem Einpacken unserer Habseligkeiten. Einen Teil davon lagerten wir erneut ein, Haushaltsgeräte etc. konnten wir auf Kosten meines neuen Arbeitgebers nach Pakistan schicken. Ende Juni stand unser braves Auto - vorsichtshalber mit neuem Motor und Getriebe - gepackt wie in alten Zeiten vor der Tür.
Zum erstenmal fahren wir mitten im Sommer aus Deutschland ab. Die Balkan-Länder schwelgen noch in Grün, doch je weiter wir nach Süd- Osten gelangen, umso unerbittlicher brennt die Sonne. In den Wüstenstrichen des Iran herrschen Temperaturen von über 40 Grad, der Fahrtwind, der eigentlich kühlen sollte, bläst wie die Luft aus einem heißen Haartrockner ins Auto. Irgendwo in der schattenlosen Wüste länger anzuhalten, kommt einem Grillerlebnis gleich - allerdings meint man selbst auf dem Rost zu sitzen. Jetzt macht sich der zusätzliche Ölkühler bezahlt, den ich noch in den letzten Tagen vor der Abreise ins Auto baute: während wir früher bei derartigen Wärmegraden immer wieder anhalten und Kühlpausen für den Motor einlegen mußten, bleiben wir nun unterhalb der kritischen Temperaturen.
Wir fahren zügig. Bald schon treffen wir in Afghanistan ein. In Herat bummeln wir durch den Bazar, besuchen die Moschee und feilschen mit den Händlern. Wir sind überglücklich, wieder zurück zu sein in diesem Land. Auch die Hauptstadt Kabul hat sich kaum verändert. Wir erforschen die paar Neuigkeiten und genießen die alten uns so lebendigen Plätze. Wir machen schnell einen Abstecher in das kleine Dörfchen Istalif, um dort für unseren Haushalt in Pakistan Keramik-Eßgeschirr zu erwerben: eine komplette Ausstattung für 8 Personen können wir zu DM 30,- erhandeln.
Aber zu bald müssen wir Afghanistan verlassen. An der Grenzstation am Khyber-Paß heißt uns der pakistanische Beamte als "residents" in seinem Land willkommen, unser Reise-Status ist damit offiziell mal wieder beendet, ein seßhaftes Leben als "Gastarbeiter" wird beginnen. Vom Khyber-Paß sind wir noch knappe 5 Stunden bis nach Haripur unterwegs. Je näher wir unserer neuen Heimat kommen, umso gespannter sind wir, nehmen jedes Detail der Umgebung kritisch wahr: wird unser künftiges Haus, unser Garten so oder so aussehen?
An einem späten Samstagnachmittag halten wir vor einem Schlagbaum, hinter dem sich die T & T Colony verbirgt. T & T steht fürTelefon- und Telegrafenverwaltung von Pakistan; eine Colony wurde dort in den fünfziger Jahren gegründet, um Angestellte und Arbeiter einer von Siemens errichteten Telefonfabrik anzusiedeln. Gleichzeitig wurde innerhalb der Colony das Telecommunication Staff College als Ausbildungsstelle für die Ingenieure und Techniker der T & T gebaut.
Auf der Suche nach dem College fällt uns auf, daß diese Colony für pakistanische Verhältnisse sehr gepflegt ist. Baumreihen säumen die sauberen Straßen, hinter hohen Hecken verbergen sich die Einheits- Ziegelhäuser der Bewohner. Schließlich finden wir meinen künftigen Chef, einen von der Bundespost freigestellten Beamten, der als Project Manager für die Aktivitäten der Fernmelde-Union hier verantwortlich ist. Er zeigt uns voller Stolz seine Dienstvilla, deren Bau er in zäher Kleinarbeit der T & T abringen konnte. Dieses Haus ist mit Abstand das größte und beste in der Colony und es dürfte, wie uns später klar wird, das beständigste Denkmal des Entwicklungshilfe-Projektes werden.
Der Project Manager steht einem Experten-Team vor, das aus einem Engländer, einem Kanadier und - nach unserer Ankunft - aus drei Deutschen besteht. Wir alle üben nur beratende Funktionen aus. Wir sollen in unserem jeweiligen Fachgebiet zusammen mit pakistanischen Kollegen - den Counterparts -Kurse für die verschiedensten Studentengruppen erarbeiten, diese Kurse halten und die Counterparts soweit ausbilden, daß sie nach Beendigung unseres Auftrags selbständig weiterarbeiten können. Die offizielle Unterrichtssprache am College ist Englisch.
Wir besichtigen unser künftiges Haus. Es wurde bereits vor zwei Jahren gebaut, aber seither wohnten nur Bauarbeiter zusammen mit ihren Familien und ihrem Viehzeug dort. Gerade machen sich Anstreicherkommandos darüber her, den Dreck der Vorbewohner zu übertünchen. Ein paar Tage später können wir, nach heftigen Beschwörungen der Handwerker, einige Räume provisorisch beziehen. Wir räumen kurzerhand die gesamte Wohneinrichtung aus unserem VW- Bus ins Haus um. Es gibt in Pakistan keine "Möbel-Märkte", jedes einzelne Möbelstück muß wie in der guten alten Zeit vom Schreiner nach Bestellung und Maßangabe gefertigt werden. So dauert es viele Wochen, bis unser Haus endgültig eingerichtet ist.
Zu meinen ersten dienstlichen Unternehmungen gehört es, den Ist- Zustand der Stromversorgungs-Technik festzustellen, über die ich unterrichten soll. Weil es keine brauchbaren Statistiken gibt und um ein eigenes Bild von den Problemen vor Ort zu gewinnen, brechen wir bald zu einer Rundreise durch Pakistan auf. Die Reise fällt unglücklicherweise in die vierwöchige Fastenzeit - Ramadan -, in der die Moslems zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang fasten müssen: weder essen, noch trinken, noch rauchen. Mit Erstaunen stellen wir fest, daß sich sicher 90 % und mehr der Bevölkerung ganz strikt an die Regeln halten. Zwar läuft nach außen hin das Wirtschaftsleben in dieser Zeit seinen gewohnten Gang, aber es läßt sich nicht verleugnen, daß selbst bei gutem Willen ein Arbeitstag mit leerem Magen lang und hart ist.
Wir besuchen Quetta, die Provinzhauptstadt von Belutschistan, der man ihre auch äußerliche Verwandtschaft mit dem nahegelegenen afghanischen Kandahar deutlich ansieht. Dann bleiben wir ein paar Tage in der "Industrie-Metropole" Karachi, die nach der Teilung von Indien aus dem Boden gestampft wurde und sich als ziemlich gesichtslose, flächenmäßig sehr ausgedehnte Stadt darstellt.
Für einen kurzen Abstecher fahren wir nach Tata, wo wir neben alten Grabdenkmälern eine in Architektur und Details sehr schöne Moschee sehen. Auf dem Weg nach Norden besuchen wir Mohendjo Daro, einen der Hauptorte der vor über 4000 Jahren blühenden sogenannten Indus- Kultur. Wir bewundern die damals bereits zweistöckigen Ziegelhäuser, ein öffentliches Bad und das Kanalisations-System. Schließlich kehren wir über Multan und Lahore zurück nach Haripur.
Das offizielle Ergebnis der Reise betrachte ich als Herausforderung: auf meinem speziellen Fachgebiet kennt sich fast niemand richtig aus, für eine systematische Schulung und Unterrichtung schien jeder dankbar zu sein, mit dem ich sprach.
Unser Privatleben wird bald in die für ausländische Experten in der Dritten Welt typischen Bahnen gelenkt. Es läßt sich nicht vermeiden, daß wir einen Koch einstellen müssen, weil sonst die Haushaltsführung entsetzlich viel Zeit fressen würde; weil es z.B. kein Brot - die Pakistaner essen hauptsächlichFladenbrot - zu kaufen gibt, muß zu Hause gebacken werden. Mehl, Reis und ähnliche Produkte müssen mühselig auseinandersortiert werden: Würmer, Steine und Dreck auf die eine, der verbleibende Rest auf die andere Seite.
Das Einkaufen muß nach pakistanischer Sitte möglichst ein Mann besorgen, weil Frauen außerhalb des Hauses nicht viel gelten. Unser Koch ist vom frühen Morgen bis zum Abwaschen nach dem Mittagessen und um die Abendessenszeit vollauf beschäftigt.
Unser Haus besteht aus fünf Zimmern, einer großen Küche, drei Bädern und einem weitflächigen Innenhof, dazu einer Garage, in der unser VW- Bus mit Leichtigkeit Platz findet. Täglich muß alles von einer Putzfrau geputzt werden, weil sonst der feinkörnige Staub aus der Umgebung kaum zu ertragen ist.
Neben dem Haus und im Innenhof lassen wir Gärten anlegen, die von einem halbtags beschäftigten Gärtner betreut werden. Und als bei einem Nachbarn eingebrochen wird, stellen wir schließlich auch noch einen Nachtwächter an.
Die vielen Probleme, die von diesen Angestellten ausgehen, belasten uns; außerdem stört uns die simple Tatsache, daß wir fast nie allein in unseren vier Wänden sind. Bald schon wünschen wir uns einen Supermarkt herbei, wo man alle Lebensmittel ohne Zeitaufwand und in hygienisch einwandfreiem Zustand erwerben kann. Wenn dann noch eine Spülmaschine da wäre, würden wir mit Freuden auf die Dienste des Kochs verzichten.
Obwohl wir fast doppelt so hohe Löhne wie die Pakistaner an unsere Hausangestellte zahlen, klingen die DM-Beträge beschämend niedrig: Der Koch verdient DM 90 im Monat,die Putzfrau DM 40, der Nachtwächter DM 50 und der Gärtner DM 35; hinzukommen noch etwa 2-3 Monatsgehälter pro Jahr für Kleidung, Geschenke etc. Man muß aber diese Einkommen in Relation zum gesamten Lohnniveau in Land sehen: der Direktor des College - ein Beamter etwa im Rang eines Ministerialrates - verdient zwischen DM 500 und DM 600, ein Beamter im höheren Dienst etwa DM 300 und ein Beamter des gehobenen Dienstes ca. DM 200, die zahllosen Arbeiter im College werden mit DM 50 im Monat abgespeist, ein mir zugeteilter Büro-Diener ist Tagelöhner zu DM 1 pro Tag. Auf der anderen Seite gelingt es den Leuten, sich mit den relativ sehr billigen Lebensmitteln und bei Mieten um DM 10/Monat für eine Beamtenwohnung halbwegs durchs Leben zu schlagen.
Neben den Problemen mit den Hausangestellten stört uns das Ghetto- Leben in der Colony. Eine solch kleine Gruppe von Ausländern trifft sich natürlich häufiger, ist auch viel mehr aufeinander angewiesen. Aber wenn eine Party die andere Party mit immer wieder denselben Teilnehmern und denselben Gesprächen ablöst, erscheint uns das auf die Dauer langweilig. Wir versuchen mit den Pakistanern Kontakte zu knüpfen.
Bezeichnend für unsere Bemühungen ist die Geschichte mit dem Bankmanager der Colony. Der etwa 25jährige, weltgewandte junge Mann lädt uns zu seiner Hochzeit ein. Seine Frau, eine Cousine zweiten Grades, wurde von den Eltern ausgewählt (auch heute noch sind 80 Prozent der Ehen arrangiert), die Hochzeit zieht sich über fast eine Woche hin. In dieser Zeit müssen mehr als 1200 Gäste bewirtet werden. Die Feiern finden in einem Damenzelt, zu dem wir Männer keinen Zutritt haben, und in einem Männerzelt statt. Die Männer sitzen den ganzen Tag herum, unterhalten sich, essen und trinken Wasser - Alkohol ist bei Muselmanen zumindest offiziell verpönt.
Im Damenzelt geht es wesentlich lustiger zu, dort tanzen die über und über goldgeschmückten Mädchen, Geschenke sind aufgestapelt und werden bewundert. Zwar versucht die Regierung per Gesetz, die Kosten für Hochzeiten einzudämmen; wir waren später zur Hochzeit eines Bauern eingeladen, dort nahmen nur 700 Gäste teil, das Essen war etwas bescheidener...
Kurze Zeit später laden wir den Bankmanager mit seiner jungen Frau zu uns ein. Die Frau, obwohl in der Großstadt Rawalpindi aufgewachsen, legt nur ungern den Schleier ab - sie kommt sich nackt vor, gesteht sie. Sie hat Englisch studiert und ist Englisch- Lehrerin an einer Mädchenschule. Trotzdem wagt sie es nicht, mit mir - dem fremden Mann - direkt zu sprechen. Sie bittet ihren Mann in der Landessprache Urdu, mir dieses oder jenes mitzuteilen oder sie beantwortet meine Fragen ihrem Mann mit der Bitte es mir zu sagen. Mit Sigrid allein klappt die Verständigung wesentlich besser, obwohl sie auch bei ihr mit Hemmungen Ausländern gegenüber zu kämpfen hat.
Natürlich drehen sich viele Gespräche mit Pakistanern um die Rolle der Frau. Wir versuchen zu verstehen, daß Frauen im Haus voll regieren und von dorther sicher auch einen weiten Einfluß in die Männerwelt vor der Haustür haben; daß andererseits der Mann seiner Familie mit Haut und Haar verpflichtet ist und daß sich die meisten Männer wohl auch für ihre Familie aufopfern würden. Bei dieser Rollenverteilung fühlt sich die Frau beschützt, viele Probleme werden von ihr ferngehalten. Letztlich stellt der Schleier das äußerliche Symbol dieses Schutzes dar: sie selbst kann alles beobachten, wird selbst aber nicht erkannt. Diese gesellschaftliche Situation trifft mehr oder weniger auf alle muselmanischen Länder zu. Die Beachtung der Koran-Lehren und -Verhaltensvorschriften zeigt weltweit eher eine Renaissance; Emanzipationsbewegungen im westlichen Sinn dürften zumindest vorläufig kaum eine Chance haben.
Wir versuchen diese Situation zumindest wertfrei als das zu nehmen was sie ist: der Sittenkodex eines Volkes, bei dem wir als Gäste leben. Auf der anderen Seite sind wir nicht bereit, unsere Vorstellungen von partnerschaftlichem Verhalten aufzugeben und Einladungen getrennt für Männlein und Weiblein zu arrangieren. Das wiederum ist den meisten unserer einheimischen Gäste derart ungewohnt, daß Hemmungen nicht abgebaut werden, Gespräche ins Stocken geraten, peinliche Pausen durch Phrasen überbrückt werden müssen. Viele Kontakte erschöpfen sich nach der ersten Begegnung. Wir bleiben letztlich die Fremden und die Fremdkörper in einer Kultur, deren Wertvorstellungen ganz anders als die unseren sind.
Auch meine Erfahrungen im College bestätigen diese so fremde Welt. Der orientalische Fatalismus macht uns Ausländern immer wieder zu schaffen. Physikalische und technische Vorgänge lassen sich nur rational erfassen und beurteilen; ein fatalistisches Abwarten, daß ein rational vorhersehbarer Fehler nicht eintreten werde, verschlimmert höchstens den Zustand eines Gerätes.
Andererseits sehen wir die Probleme der pakistanischen Counterparts, die sich entweder selbst profilieren wollen oder die ihre Arbeit ausschließlich uns überlassen. Eine echte Zusammenarbeit im Sinn von Geben und Nehmen, von Lehren und Lernen ist ungeheuer schwierig. Zwar finden wir uns schließlich damit ab, daß der Erfolg nur bescheiden sein kann. Aber diese frustrierende Einsicht ist hart. Sie führt schließlich dazu, daß Sigrid und ich beschließen, nach Ende des Vertrages keine neue, ähnliche Stelle zu suchen, sondern nach Deutschland zurückzukehren.
Trotzdem bemühen wir uns, Land und Leute so gut wie nur irgend möglich kennenzulernen. Wann immer Wetter und die bescheidene Freizeit es erlauben, erforschen wir die nähere und weitere Umgebung zu Fuß, per Fahrrad oder natürlich per Auto. Es ist für uns ein ganz neues Erlebnis, den Wechsel der Jahreszeiten, Trocken- und Regenzeit an ein- und demselben Ort zu beobachten. Wir können nicht genug bestaunen, wie nach Beginn der sommerlichen Regenzeit die Natur völlig explodiert, wie sich die nackte Erde zusehends mit einer dichten, grünen Decke überzieht, wie Blumen in die Höhe schießen und sich das Land in wenigen Augenblicken fast völlig verwandelt.
In unserem eigenen Garten erleben wir, wie Bananenpflänzchen innerhalb weniger Monate zu drei Meter hohen Stauden emporwuchern, sich die Blüte entfaltet und Büschel für Büschel winzige grüne Bananen herauswachsen und reifen. Wenn wir in dieser Zeit nachts mit unserem Hund spazierengehen, liegt auf den Straßen der betörend-verführerische Duft der "Königin der Nacht", deren fast unscheinbare Blüten sich nur in der Dunkelheit öffnen.
In den Sommer 1976 fällt auch der Höhepunkt unserer Reise- Aktivitäten. Anfang Juni fliegen wir von Pakistan aus für neun Tage in die Volksrepublik China. Die Gruppenreise wird von den Pakistan International Airlines für im Land lebende Ausländer veranstaltet, die direkt von Islamabad/Rawalpindi nach Peking fliegen. Der Flug selbst ist schon ein erstes, großartiges Erlebnis: das Flugzeug muß sich vom 500 m hoch gelegenen Flughafen in Rawalpindi in einer Spirale so hoch schrauben, daß es die Himalaya-Riesen Nanga-Parbat und K2 sicher überfliegen kann. Je höher wir hinauf-spiralen, umso weiter öffnet sich der Blick auf die Himalaya-Kette, dann dreht die Maschine nach Nordost ab, ein Schneegipfel neben dem anderen liegt buchstäblich zu unseren Füßen.
Leider verbirgt sich China unter einer Wolkendecke, die erst in Peking aufreißt. Der Flughafen von Peking macht zwar einen etwas bescheidenen Eindruck, aber die Chinesen fertigen uns zügig und freundlich ab, alles ist ungeheuer sauber und ordentlich - für einen aus Pakistan kommenden Touristen eine ungewohnte Überraschung.
Die Chinesen geben sich sehr viel Mühe, ihr Land aus den verschiedensten Perspektiven zu zeigen. Man führt uns - ganz offenbar wieder voller Stolz - durch die historischen Bauten wie die Verbotene Stadt (mit deren Riesenhaftigkeit und, auf der anderen Seite, traumhaft schönen Details wir uns am liebsten eine Woche lang beschäftigt hätten), den Sonnenaltar und den Sommerpalast. Natürlich fahren wir zu der typisch chinesischen Fleißarbeit, der 6000 km langen Mauer. Aber wir besichtigen auch Schulen, Kindergärten, Fabriken, eine Komune, ein Krankenhaus und besuchen private Familien in Peking. Unser Programm beginnt pünktlich um 7.30 Uhr und endet meist nach 22 Uhr, nur die hervorragende chinesische Küche hält uns aufrecht.
Per Eisenbahn fahren wir eines Nachts im pieksauberen Schlafwagen nach Tsinan, besuchen dort ein ehemaliges buddhistisches Kloster und am Nachmittag eine Fabrik. Nachts geht es wieder per Schlafwagen weiter nach Nanking. Von dort machen wir einen zweitägigen Omnibusausflug hinaus ins Land nach Yangchow. Wir gewinnen einen Eindruck von Dörfern und von den Lebensbedingungen auf dem Land. Ein paar Tage später fliegen wir zurück nach Peking und von dort schließlich wieder nach Pakistan.
Vielleicht gerade weil wir aus einem Land der Dritten Welt nach Rotchina kamen und weil der Unterschied zwischen beiden Nachbarländern so ungeheuerlich groß ist, vielleicht waren wir deswegen umso tiefer von dem beeindruckt, was die Chinesen geleistet haben. Es beginnt schon damit, daß in Rotchina das sonst gewohnte Chaos fehlt: kein Dreck, kein Durcheinander, keine Unzuverlässigkeit. Man kann in jedem Restaurant unbesorgt essen, überall Wasser trinken, nirgendwo wird gestohlen. Zwar sind die Chinesen uniform angezogen, aber sie tragen Kleider am Leib, die nicht aus Fetzen bestehen. Es gibt keine Bettler, man sieht keine Kranken auf der Straße dahinsiechen. Die Märkte sind mit Waren zu erschwinglichen Preisen gefüllt, niemand verhungert, jeder hat ein Dach über dem Kopf. Wirtschaftlich ist Rot-China dabei, sich zu einer modernen Industriemacht emporzuschwingen.
Unabhängig von jeder ideologischen Einstellung zeigt sich für uns, daß dieser Fortschritt das Werk Maos ist. Dieser Mann hat die Gunst der Stunde erkannt und genutzt, er hat es fertig gebracht, 500 Millionen oder mehr Menschen zu motivieren, eines der damals rückständigsten Länder der Erde aus eigener Kraft umzukrempeln und eine Begeisterung für die Erneuerung des Riesen-Reiches zu entfachen, die buchstäblich Berge mit den bloßen Händen versetzte. Mao hat Traditionen und erstarrte religiöse Riten zerschlagen, er konnte auf der anderen Seite auf ein Volk bauen, das traditionell fleißig und zu gemeinsamem Handeln erzogen war. Die Frage, ob Mao in Indien ähnlich erfolgreich gewesen wäre, läßt sich kaum beantworten; zumindest hätte er es bedeutend schwerer gehabt. (Mao, dem wir all überall in Gips oder Beton oder nur im Foto begegneten, starb wenige Monate nach unserem Besuch.)
Aus der Sicht der Entwicklungshilfe sollte das Beispiel Rot-Chinas sehr genau analysiert werden: die Chinesen haben, nachdem sie von den Russen sitzen gelassen wurden, ihre Wirtschaft und Technologie selbst entwickelt. Natürlich mußten sie bittere Rückschläge einstecken, aber sie lernten aus den Fehlern und verbesserten sich im nächsten Schritt. Die anderen Länder der Dritten Welt beziehen fertige Technologien ohne die - bittere - Chance, aus den eigenen Fehlern lernen zu müssen. Sie ahmen dann Fabrikationsprozesse nach, schauen zu und sprechen erlerntes Wissen nach. Ihnen fehlt aber häufig der wirkliche Bezug zur Praxis, das Wissen um Bedeutung und Wertigkeit von Details oder Einzelprozessen.
Die Fastenzeit der Muselmanen fällt in jenem Jahr mitten in den Sommer. Bereits kurz nach 4 Uhr morgens ruft der Muezzim per Lautsprecher vom Minarett der Moschee zum Gebet. Bis zum Sonnenuntergang nach 19 Uhr bleiben Speisen und Getränke unberührt. Während der Fastenzeit finden gewöhnlich keine Kurse im College statt, ich nehme ein paar Tage Urlaub und wir fahren nach Nordindien. Wieder sind wir fasziniert von diesem Land - und können es nicht versäumen, erneut das Taj Mahal zu besuchen, uns wiederum von der Majestät seiner Architektur fesseln zu lassen.
Bald nach der Rückkehr aus Indien beginnen die ersten Vorbereitungen für unsere Abreise aus Pakistan. Am 28. Oktober 1976 haben wir alle Abschiedspartys hinter uns. Die zum Teil rührenden Abschiedsgeschenke der Pakistaner sind verstaut. Bei strahlendem Sonnenschein verlassen wir mit Resignation und Trauer einen Ort, an dem wir vor 16 Monaten voller Idealismus und Pläne angekommen waren.
Wir planen, über Quetta, Shahedan, Isfahan nach Bagdad zu fahren. Aber auch am Tag der Abreise liegt das Visum für den Irak nicht vor. Der Beamte vertröstet uns, er würde das Visum nach Teheran schicken. Daher ändern wir unsere Pläne und fahren direkt über Kabul nach Teheran. Aber auch dort ist kein Visum eingetroffen. So bleiben wir auf der dichtbefahrenen "Ölspur" bis Shivas in der Türkei, biegen dort nach Südwesten ab und besuchen Kayseri und Göreme. Bald jedoch flüchten wir vor der empfindlichen Kälte nach Adana und von dort nach Syrien. Aber selbst der Wüstenplatz Palmyra kann uns nicht aufwärmen. Wir freuen uns, abends dem Hotel eine heiße Dusche abkaufen zu können. Auch in Damaskus macht sich der frühe Wintereinbruch unangenehm bemerkbar.
Wir kehren um nach Norden, folgen der Mittelmeerküste bis Antalya in der Türkei. Auf der Weiterfahrt treffen uns Schneeschauer, der Grenzübergang nach Griechenland ist vereist. Auch Saloniki - wo wir eine Pause einlegen wollten - überrascht uns mit Schneeschauern. Am nächsten Morgen liegt tiefer Schneematsch auf der Straße nach Skopje, auf vereisten Brücken hängen Autotrümmer im Geländer. Als wir schließlich an einem strahlenden Dezembersonntag Deutschland erreichen, hat sich eine dichte, in der Sonne glitzernde Schneedecke ausgebreitet. Unsere pakistanische Hündin Judy springt aus dem Auto, tobt und wälzt sich im Schnee, als ob sie in diesem Element aufgewachsen wäre.
Diesmal sind wir froh, zuhause zu sein.
Wieder einmal - im Frühjahr 1979 - gibt es eine Geschichte nachzutragen. Vor wenigen Tagen kamen wir aus Afrika zurück, dem letzten Kontinent, den unser braver VW-Bus noch hinter sich zu bringen hatte. Leider war es nur eine Dreimonate-Reise, die uns bis zur Atlantikküste Westafrikas und zurück führte, aber die zweimalige Saharadurchquerung hat uns begeistert - und unser Auto strapaziert.
Das erste Abenteuer bestanden wir noch vor der Abreise. Wir ließen aus Sicherheitserwägungen alle Verschleißteile wie Motor und Getriebe (obwohl beide erst 65 000 km alt waren) in einer VW-Werkstatt in München-Moosach ersetzen. Obwohl mir der Eigentümer versicherte, besonders sorgfältig zu arbeiten (er habe mehrere "Wüstenfahrer"-Kunden), kam nach einwöchiger und 6.000 DM teurer Reparatur das Auto mit lebensgefährlichen Mängeln aus der Werkstatt. So sagte ein TÜV-Mann, der den Wagen am nächsten Tag untersuchte und natürlich nicht abnahm. - Die nötigen Nachreparaturen dauerten sieben Arbeitstage.
Zu jener Zeit hätten wir ernsthaft eine Neuauflage unseres Buches "Nie wieder im VW-Bus um die Erde" getauft. Nachdem in Nigeria weitere bemerkenswerte Fehlleistungen eines österreichischen Meisters in einer offiziellen VW-Werkstatt hinzukamen, müßten wir jetzt umso mehr zum neuen Buchtitel neigen. Jedoch hat sich andererseits unser Bus so tapfer auf den schlimmsten Pisten geschlagen, daß ein solches Urteil ungerecht und unzutreffend wäre. Man muß differenzieren: Konzeption und Fahrwerk sind hervorragend, der Motor gehört nicht zu den zuverlässigsten, er ist aber relativ preiswert. Der VW-Kundendienst ist nach meinen subjektiven Erkenntnissen so schlecht, daß ich ihn nach 9-jähriger Erfahrung nurmehr mit sehr viel Skepsis in größter Not in Anspruch nehme.
Das zweite Abenteuer fand während der Abreise statt: Ein Polizist entdeckte die acht an der linken Fahrzeugaußenseite befestigten Benzinkanister und Sandbleche und verlangte eine Sondergenehmigung des TÜV. Das war vormittags um 9.30 Uhr, abends um 22 Uhr mußten wir im 800 km entfernten Hafen von Genua auf dem Fährschiff nach Tunis erscheinen. "Wenn Sie die Sondergenehmigung nicht einholen, ziehe ich den Wagen sofort aus dem Verkehr", drohte er. Nach 15 Minuten erregter Diskussion gab der Bürokrat nach. Er war trotzdem überzeugt, daß man selbst in der Sahara nur mit einer Sondergenehmigung des TÜV fahren dürfe.
Nach all diesen Aufregungen gestaltet sich der Rest der Anreise sehr erholsam. Die Alpenkette liegt in strahlender Herbstsonne, die uns über ein spiegelglattes Mittelmeer begleitet und uns bis zur Rückkehr nach Genua nicht mehr verläßt.
Das nördliche Nordafrika betrachten wir als Anreisegebiet, wir fahren zügig und ohne große Unterbrechungen. Im Grenzgebiet Tunesien/ Algerien bei Nefta wirbelt ein sehr starker Wind den Flugsand bis in Augenhöhe, das ist so unangenehm, daß selbst die algerischen Zöllner auf eine Auto-Kontrolle verzichten. In der Oasen-Siedlung Ghardaia legen wir eine erste Besichtigungspause von knapp zwei Tagen ein. Wir lassen uns von der immer noch strenggläubigen Islam-Welt der Mozabiten-Sekte fesseln, strolchen durch die manchmal nur schulterbreiten Gassen oder ruhen uns im Palmenhain aus. Dann fahren wir über El Golea nach Timimimoun und machen dort eine 50 km-Rundreise durch die einzelnen Oasen. Das ist eine reine Pistenfahrt, und am Ende sind wir über das Fahrverhalten unseres wieder mal überladenen Wagens sehr beruhigt. Wir sehen der Wüste gelassener entgegen.
Vierzehn Tage nach der Abfahrt von Tunis erreichen wir Adrar. Hier gibt es zum letzten Mal vor der Tannesrouft-Piste Super-Benzin und gutes Wasser. Wir beschäftigen uns nochmal einen Tag lang mit dem Auto, prüfen alle Funktionen und befestigen unter Motor und Getriebe ein starkes Drahtgitter als Steinschlagschutz.
Dann tanken wir 400 Liter Benzin: 60 in den Fahrzeugtank und 340 in 17 (in Worten: siebzehn) Benzinkanister. Denn wir rechnen für die vor uns liegende 1 400 km lange Tannesrouft-Piste mit einem Verbrauch von etwa 350 Litern, die restlichen 50 Liter sind Reserve (auch für den Fall, daß es in Gao am anderen Ende der Piste wie so häufig kein Benzin geben sollte). Von den 17 Benzinkanistern packen wir neun aus Gewichtsverteilungsgründen in unser Bett; und müssen sie Abend für Abend - als Ausgleichsgymnastik - aus dem Auto räumen. Die restlichen acht, an der rechten Fahrzeugseite befestigten Kanister ragen vom Heck bis zur Hälfte der Fahrertür und zwingen mich seit Beginn der Reise, jedesmal durch die Beifahrertür auszusteigen.
Von Adrar aus liegen noch 150 km Asphaltstraße bis nach Reggane vor uns, dann beginnt die Piste. In Reggane stoppt uns ein Polizeiposten. Die Tannesrouft-Piste darf nur im Konvoi befahren werden. Wir müssen auf mindestens einen Partner warten. Immerhin können wir schon mal per Fernglas die Strecke begutachten. Über der brettflachen Ebene flimmert die Hitze, bis zum Horizont Sand, nichts als gelbbrauner Sand. Wir fühlen beide die Spannung und die Erwartung: wie werden wir mit dieser Strecke fertig werden.
Eine Stunde später taucht ein französischer Peugot-Fahrer auf, er überführt ständig PKW’s nach Mali - und ist, genau wie wir, nicht an einer gemeinsamen Konvoi-Fahrt interessiert. Aber der Bürokratie ist Genüge getan. Genau um 12 Uhr mittags dürfen wir gemeinsam starten.
Um 12.15 Uhr sitzen wir zum ersten Mal im Sand fest, der Franzose gibt Gas und fährt davon.
Wir essen erst mal gemütlich zu Mittag, dann schaufeln wir den Sand zur Seite, heben den Wagen an der Hinterachse an und stellen ihn auf Sandbleche. Vor die Vorderräder legen wir ein zweites Paar Sandbleche. Diese kurze Startbahn genügt, und wir sind frei. Ohne weiteres Steckenbleiben kommen wir durch die gefürchteten ersten 50 km mit sehr vielen Weichsandstellen.
Und schon erleben wir ein "Jahrhundertereignis". Ein Lastwagen ist auf einen anderen, der im Sand stecken geblieben war, aufgefahren. Auf einer Piste, die an dieser Stelle wohl 10 km breit ist und auf der höchstens alle halbe Tage ein LKW daherrumpelt ...
Die Tannesrouft-Piste: das sind Spuren im Sand, die mehr oder weniger dicht einer Markierung aus Bezinfässern folgen. Diese Fässer sind meist in Sichtweite aufgestellt, häufig fehlt jedoch das eine oder andere Faß und man muß hoffen, das nächste zu finden.
Die Tannesrouft-Wüste gehört laut Reiseführer zu den ödesten der Welt. Sie ist flach wie ein Kuchenteller und fast gänzlich tot. Für uns war die Tannesrouft die faszinierenste Wüste, die wir je erlebten. Das Bewußtsein der totalen Einsamkeit, das Erlebnis der völligen Stille und das Schauspiel der Sonnenuntergänge: man sitzt im Zentrum dieses Kuchentellers, die Sonne nähert sich eilig und frei von jedem Dunstschleicher dem Rand des Horizonts; klar leuchtend und selbstbewußt fährt der Sonnenball in die Tiefe. In atemberaubenden fünf Minuten ist alles vorbei. Im Rücken erscheint violett, dann blau, dann schwarz die Nacht, fast so schnell wie die Sonne verschwindet. Wenig später bedeckt ein ungemein klares Sternenmeer den Nachthimmel.
Bis zur 750 km entfernten algerischen Grenzstation Bordj Moktar sind wir zweieinhalb Tage unterwegs, bleiben noch zweimal im Sand stecken und fahren hauptsächlich im 2. oder 3., lange Strecken aber auch im 1. Gang. In der Gegend der Mali-Grenze ändert sich das Landschaftsbild. Die Piste schlängelt sich durch Gebirgsketten, es gibt häufig keine Ausweichspuren mehr, man muß auf dem harten, wellblechartigen Pistenboden bleiben. Manchmal tauchen Beduinen aus dem Nichts auf, bitten um Wasser und verschwinden im Nichts. Später dann sehen wir die typischen Ziehbrunnen des Sahelgürtels, um die sich Kamel- und Zebu-Herden drängen.
Genau fünf Tage nach dem Start erreichen wir Gao, die graubraune Lehmhäuser-Stadt am Niger. Eigentlich ist uns die Reise durch die Wüste zu schnell gegangen, gern würden wir ein paar Tage in der Einsamkeit geblieben sein. Aber wir hatten von entgegenkommenden Deutschen gehört, daß der Niger-Flußdampfer jeden Tag in Gao erwartet würde. Und mit diesem Dampfer wollen wir weiter nach Mopti tuckern. Aber der Reederei-Angestellte gibt uns lakonisch zur Auskunft, das würde sicher noch 10 Tage dauern - was in Afrika leicht 20 Tage und mehr bedeuten kann.
Dafür entschädigt uns Gao mit einem Empfang für den Präsidenten der Republik. Bereits am frühen Morgen strömen die Stämme des Bezirks in ihren besten und buntesten Trachten auf dem Sportplatz zusammen. Tuareg jagen auf weißen, hochmütigen Rennkamelen durch die Menge, Musikbands spielen heiße Rhythmen, Tänzer lassen sich auch von Polizeihieben nicht einschüchtern, fröhliche und ausgelassene Menschenmengen wogen hin und her. Wir werden mitgerissen, integriert und jubeln wie alle dem Präsidenten zu, der schließlich mit drei Stunden Verspätung durch die Menge drängt.
Wir versuchen, per Straße nach Mopti und zum Stamm der Dogon zu kommen. Aber diese Straße ist eine Sammlung von Spuren, die querfeldein führen. 600 km liegen vor uns, am ersten Tag schaffen wir 80 - und geben schweren Herzens auf. Denn damit müssen wir auf Mopti endgültig verzichten.
Stattdessen fahren wir nigerabwärts nach Niamey, der Hauptstadt der Republik Niger. Niamey ist eine relativ junge Stadt, sehr geschäftig und ziemlich gepflegt. Am besten gefällt uns das Museum, das nicht nur der Geschichte gewidmet ist, sondern auch das heutige Leben zeigt mit Handwerks- und Kunsthandwerksbetrieben, sogar einem kleinen Zoo.
Über eine harte Wellblechstraße fahren wir nach Obervolta und dort in den Parc du W, ein großes Drei-Länder-Tierreservat. Die Anfahrt vom letzten Dorf bis zum Park ist 45 km weit, sie beschäftigt uns auf ganz schlimmen Feldwegen fast zweieinhalb Stunden. Als wir 5 km weit in den Park gefahren sind, versperrt uns eine tiefe Querrinne den Weg. Ohne stundenlanges Wege-Bauen kämen wir nicht weiter, und der Parkwächter hatte uns von vielen Querrinnen erzählt. Wir übernachten und kehren am nächsten Morgen um, ohne auch nur eine Maus gesehen zu haben. Im etwa 100 km entfernten Parc Arly haben wir etwas mehr Glück, dort laufen uns zweimal Bison-Herden und recht viele Gazellen über den Weg.
Obervolta ist von der Landschaft her ein sehr uninteressantes Land: es ist flach und von grauem, dürftigem Buschwerk überzogen. Aber seine Bewohner machen diesen Eindruck bei weitem wett, wir treffen hier (und ähnlich auch in Mali) die freundlichsten Menschen, die uns je auf unseren Reisen begegneten. Wann immer wir durch Dörfer fahren, winken uns die Bewohner zu, kommen und begrüßen uns mit strahlender Freundlichkeit in den Augen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist diese Freundlichkeit offen und ohne Hintergedanken, der Fremde ist willkommen und man ist über seinen Besuch glücklich.
Diese Freundlichkeit spüren wir selbst in der Hauptstadt Ouagadougou. Auf dem großen Markt der Stadt können wir uns unbekümmert und unbelästigt bewegen und komplikationslos fotografieren. Wir lernen einige, in "Waga" lebende Deutsche kennen, mit denen wir die Weihnachtsfeiertage verbringen und die wir ein wenig um diesen Wohnort beneiden. - Im nahegelegenen Wildpark Po sehen wir am frühen Morgen zwei Elefantenherden direkt neben der Asphaltstraße grasen.
Unseren Plan, durch Ghana zum Atlantik zu fahren, geben wir auf, als wir erfahren, daß in jedem Dorf in Ghana mehrere Straßenkontrollen stattfinden und daß man bei jeder Kontrolle einen kleinen Schein in den Paß legen müsse, anderenfalls daure eine Kontrolle stundenlang.
Stattdessen fahren wir nach Togo. Bereits im Norden des Landes ändert sich die Vegetation. Jeden grünen Fleck nehmen wir nach der langen Reise durch Sand und graues Buschwerk besonders deutlich wahr. Eine Enttäuschung wird ein Abstecher ins Tal der Tamberma bei Kante. Diese Leute bauen ihre Rundhütten aus Stein und zweistöckig, eine Seltenheit in Westafrika. Die "Burgen" sehen recht malerisch aus und erfreuen die Augen so mancher in Bussen herbeigekarrter Touristen. Daher "kostet" ein Foto bei den Tamberma bis zu 5 DM. Da uns das zu teuer erscheint, fliegen Steine, von denen einer eine tiefe Beule in der Schiebetür hinterläßt...
Im Winter, oder genauer zur Zeit des Jahreswechsels liegt über dem Süden Westafrikas der Harmattan, ein Sand-Nebel aus der Sahara. Der Himmel ist fast immer grau, die Sicht beträgt häufig nur wenige Kilometer. Wir haben auch wenig Freude, als wir auf den höchsten Berg Togos, den Mont Agou, fahren wollen: der Harmattan nimmt uns die Sicht auf die umliegenden Kakao- und Kaffeeplantagen und auf die Reste von tropischem Regenwald. Dafür überfällt uns hier, kurz vor der Atlantikküste, die tropische Schwüle mit aller Macht. In Lome fühlen wir uns wie in der Sauna, gebadet im eigenen Schweiß. Nach der langen Zeit in knochentrockenem Klima brauchen wir sehr lange für die Akklimatisierung.
Togo war einst die Musterkolonie des Deutschen Reiches. Als Zeugen erinnern in Lome, der Hauptstadt, eine "neugotische" Kathedrale und eine nach Norden führende Eisenbahnlinie an die Vergangenheit. Aber auch die deutsche Gegenwart läßt sich nicht übersehen: weißblaue Sonnenschirme mit dem Aufdruck "Alt-München" werben für eine Biermarke. Eine in Bayern beheimatete Metzgerladenkette unterhält eine Zweigstelle, in der die schwarzen Bedienungen fließend bayerisch sprechen. Im Schaukasten eines Fotografen am Fetischmarkt entdecken wir ein Foto von Franz Josef Strauß.
Wir fahren weiter nach Cotonou in der sozialistischen Republik Benin. Dort ist Camping verboten, wir müssen ins Hotel. Daher besuchen wir am nächsten Tag nur das Pfahldorf Ganvie, das in einer Lagune liegt und in dem angeblich 20000 Menschen wohnen. Bereits nachmittags verlassen wir das in unseren Augen ungastliche Land und begeben uns in "the hell’s place", wie uns ein Amerikaner die Hauptstadt Nigerias, Lagos, beschreibt.
Über Nigeria kursieren zahllose Schauer- und Räubergeschichten, die meisten Globetrotter machen daher einen Bogen um das Land oder zumindest um Lagos. Auch wir nehmen uns vor, auf den Besuch des Landes zu verzichten, falls wir an der Grenze unsere Konserven abliefern müssen; denn offiziell sei deren Einfuhr verboten. Aber die Grenzkontrolle in provisorischen Bretterverschlägen zwischen den Leitplanken der neuen Autobahn Cotonou-Lagos verläuft zunächst unproblematisch. Am letzten Schlagbaum regt sich ein Soldat auf, daß wir so schmutzig nach Nigeria kämen. Wir sind erstaunt, denn unser Auto ist ziemlich frisch gewaschen. Aber dann deutet er auf die Blätter, die sich in der Benzinkanisterhalterung gefangen haben. Er verlangt, daß wir alles abbauen und von Laub und Staub befreien, denn wir könnten Bakterien einschleppen. Direkt neben uns hocken sich Nigerianer an die Straßenböschung und hinterlassen stinkende Haufen mit sehr vielen Bakterien.
Der Amerikaner hat nicht zu viel versprochen: Lagos ist die Hölle, das schlimmste Pflaster, das wir auf all unseren Reisen erlebten. Selbst das allerorten gefürchtete Bogota in Kolumbien ist noch ein friedlicher Platz gegenüber Lagos. Die Gefahr liegt in Lagos vor allem darin, daß die Unterschiede zwischen Straßenräubern und Polizisten verschwimmen; sehr häufig scheinen uns die Polizisten lediglich uniformierte Räuber zu sein.
Unser erstes Erlebnis dieser Art ist ein Uniformierter, der Sigrid die Kamera entreißen will, als sie ein öffentliches Gebäude fotografiert. Während wir gemeinsam an der Kamera zerren, läßt der Mann seine Erkennungsmarke schnell verschwinden. Aber Sigrid gibt dann den Film aus der Kamera, und damit hat der "offizielle" Räuber verspielt. Zuviele Zuschauer haben den Disput verfolgt. Die Geschichte ist zu durchsichtig, denn das Gebäude ist eine der Postkarten-Attraktionen.
Wenig später verfolgt uns ein Polizist, weil ich angeblich sein Stopsignal nicht beachtet habe. Wir sollen mit zur Wache kommen - jeder in Lagos weiß, daß unterwegs privat abkassiert wird. Wir gehen zum Schein darauf ein und bieten dem Polizisten einen Platz in unserem Auto an. Als der Wagen rollt, erkläre ich ihm, daß wir nicht zur Wache sondern zur deutschen Botschaft fahren werden - das erscheint ihm so furchtbar, daß er noch aus dem fahrenden Auto springt und lieber auf den Standardpreis von 30 DM verzichtet.
Die nächste Geschichte gestaltet sich unangenehmer. Wir haben den Yankara-Markt zunächst ohne Fotogerät und ohne viel Geld besucht, weil man dort beides sehr schnell los wird. Aber dieser angeblich größte Markt Afrikas ist die größte Markt-Kloake der Welt. Wir haben nirgends einen Markt erlebt, der halb in schwarzem, stinkenden Brackwasser versunken ist, der inmitten von Müllhaufen, Ratten und menschlichen Exkrementen abgehalten wird. Das wollten wir wenigstens aus dem Auto heraus fotografieren. Wir fahren durch die engen Straßen, Sigrid fotografiert eifrig. Plötzlich stoppt uns ein Polizist, der uns mit einem Taxi verfolgte. Er hämmert ans Auto, wir lassen ihn nicht hinein. Ich fahre weiter, er klammert sich an die Tür. Dann kommt ein Mauervorsprung, ich habe Angst, den Mann dort einzuquetschen, halte erneut. In Sekundenschnelle sammelt sich um das Auto ein Menschenauflauf, an Flucht ist nicht mehr zu denken. Wir müssen den Schreihals hereinlassen. Aber ein zweiter Mann schlüpft hinterher. Der Polizist sagt, wir sollen zur Wache fahren, weil Fotografieren verboten sei. Der andere, der angeblich Polizeioffizier ist, ergänzt, wir brauchten nicht zur Wache (dort ist der Preis dann viel höher, weil alle partizipieren wollen), wenn ich gleich um Vergebung bitte. "How much", frage ich nur, und er antwortet, das läge an mir. Ich biete ihm 5 Naira, aber dieser Betrag wird entrüstet zurückgewiesen. Ich erhöhe auf 10, habe aber nur einen 20-Naira-Schein (60 DM). Wechselgeld gibt es in einem solchen Fall nicht, also gebe ich den Schein heraus und die Herren steigen befriedigt aus.
Die letzte Räuberpistole passiert bei einer Polizeikontrolle, bei der uns zufällig ein Botschaftsangehöriger begleitet. Der Polizist verlangt die Papiere und erklärt mir, daß der Internationale Führerschein in Nigeria nicht gelte (obwohl Nigeria als Vertragsstaat aufgeführt ist). Ich dürfe ohne nigerianischen Führerschein nicht fahren, deshalb würde er mich jetzt verhaften. Unserem Begleiter gelingt es schließlich, dem Polizisten den Führerschein abzulisten und den Mann mit diplomatischen Verwicklungen so zu drohen, daß er sein Vorhaben aufgibt.
Wir halten trotz allem eine Woche lang in Lagos aus. Aber auch nur, weil wir in einem Haus mit Nachtwächter wohnen und uns dort von den Aufregungen der Stadt in klimatisierten Räumen erholen können. An Camping ist in oder in der Nähe von Lagos überhaupt nicht zu denken, denn nachts herrscht nur mehr Faustrecht. Bei Überfällen ist selbst eine falsche Handbewegung lebensgefährlich; wer lebendig davonkommen will, liefert alle Wertgegenstände wie Geld, Uhr und Auto auf der Stelle ab und steht nicht im Weg herum.
Wir sind überzeugt, daß alle Schauergeschichten über Lagos wahr sind, daß die Realität wahrscheinlich noch brutaler ist, als die Geschichten. Wir sind ohne Unfall und ohne ernsthafte Komplikationen davongekommen; und jetzt, wo alles hinter uns liegt, sind wir eigentlich ganz froh, auch einen Blick in die "schiere Hölle" geworfen zu haben.
Bereits ein paar Fahrstunden nördlich von Lagos liegt die Hölle hinter uns. Dort werden die Menschen wieder freundlich, die Polizisten hilfsbereit. Selbst in der zweitgrößten Stadt in Kano, ganz im Norden Nigerias, fühlen wir uns völlig sicher, fotografieren bedenkenlos, und halten uns sorglos und stundenlang im großen und interessanten Bazar auf. Kano ist ganz anders als Lagos; eine Stadt die uns gefällt und in der wir uns bald wohl fühlen.
In Kano machen wir leider einen großen Fehler. Ich meine, in den Hinterradlagern des Autos etwas zuviel Spiel festzustellen, und will sie im Hinblick auf die Saharadurchquerung vorsichtshalber auswechseln lassen. In der offiziellen VW-Werkstatt namens NITECO bedient uns ein deutscher kaufmännischer Manager und ein östereichischer angeblicher Ingenieur und Meister. Dieser Mann hatte zumindest von einer VW-Hinterachse nicht die geringste Ahnung. Er machte nahezu alles falsch, vor allem verwechselte er beim Einbau die Lager. Beim Umwechseln beschädigte er die Lager und verbog die Ankerplatte. Daraufhin schliff die Bremstrommel so an dieser Platte, daß das Rad kochendheiß wurde. Das wiederum versuchte er durch eine Kupferbeilagscheibe zu kompensieren.
Diese Scheibe zerrieb sich in Kürze, die Bremstrommel lockerte sich und schlug aus der Verzahnung aus.
Auf der Weiterreise mußte ich alle 150 bis 200 km die Bremstrommel abnehmen und die Lager überprüfen. Dabei war nicht die zusätzliche Arbeit belastend, sondern das Gefühl, daß sich irgendwann das Hinterrad nicht mehr dreht - mitten in der Sahara. Jedoch, am Ende drehte es sich bis Deutschland, allerdings mit Ach und Krach, wir hätten wohl kaum 1 000 km weiter fahren können.
Von Kano führt eine - wenn auch schlechte - Asphaltstraße nach Zinder. Auf dieser Strecke ändert sich deutlich sichtbar die Vegetation, je weiter wir nach Norden kommen, umso ungehinderter schweift der Blick über kahle Flächen. In Zinder ist gerade Markttag mit einem sehr ausgedehnten Kamelmarkt, den größten, den wir je sahen. Auch auf dem Weg nach Agadez streifen wir noch über einige kleine Dorfmärkte, immer werden wir freundlich aufgenommen.
Als wir nach zweieinhalb Tagen auf einer fast mörderischen, 400 km langen Wellblechpiste in Agadez ankommen, überfallen uns fast die Händler und Bettler. Bei einem Gang durch den Markt werden wir von aufdringlichen fliegenden Händlern begleitet; wo immer man hält, wird man sofort belästigt. Agadez wimmelt zu dieser Jahreszeit von Touristen, und es scheint, daß dieser Andrang der alten Karawanenstadt allen Zauber, alles Geheimnisvolle genommen hat.
Bald verlassen wir Agadez und starten auf der Hoggar-Piste die Süd- Nord-Durchquerung der Sahara. Bis zur gut 400 km entfernten Niger- Grenze fahren wir über ebene, feste Sandflächen. Weite Strecken lassen sich sogar im 4. Gang bewältigen. Nach eineinhalb Fahrtagen stehen wir kurz nach Mittag an der Grenzstation in Assamaka, aber die Grenzer machen zwischen 11.30 und 16 Uhr Siesta. Bis dahin sammeln sich 10 Autos, ein Zeichen für den starken Verkehr auf dieser Piste.
Zwischen Assamaka und der 30 km entfernten algerischen Grenzstation In-Guezzam liegt ein heimtückisches Weichsandstück von ca. 15 km Länge. Wir bleiben gleich zu Beginn stecken, befreien uns noch und übernachten an dieser Stelle. Am nächsten Morgen, als der Sand noch tragfähig ist, starten wir im ersten Tageslicht, und kommen durch, wenn auch mit List und Tücke.
Hier ändert sich das Landschaftsbild, von der Erosion zernagte Berge und Gebirgsketten ragen aus dem Sand. Die Piste ist für uns eigentlich ohne große Probleme zu fahren, wir kommen gut vorwärts und machen mehrere Male Abstecher zu den umliegenden Gebirgszügen. Aber das Gefühl von Wüste will nicht so recht aufkommen, alle paar Kilometer steht ein Autowrack herum, immer wieder begegnen uns andere Wagen. Wir fühlen uns nicht einsam genug und verzichten auf die lange Pause, die wir hier eigentlich machen wollten.
Ein sehr intensives Erlebnis ist allerdings die Begegnung mit Martin Eavens, einem etwa dreißigjährigen Engländer, von dem wir schon in Agadez gehört hatten. Martin ist per Fahrrad unterwegs durch die Sahara, und er hat nicht - wie seine Vorgänger - sein Fahrrad auf einen LKW verladen, sondern er kämpft sich ganz allein und mit eigener Kraft durch den Sand. Wir treffen ihn am späten Nachmittag, wir kampieren gemeinsam und unterhalten uns bis tief in die Nacht. Er sagt, daß Radfahren die optimale Fortbewegungsart für ihn sei und daß er ganz bewußt per Fahrrad durch die Wüste fährt, weil er sie kennenlernen will.
Sein Fahrrad wiegt inklusive Gepäck etwa 75 kg. Seinen 15-Liter Wasservorrat ergänzt er immer wieder von durchfahrenden Touristen, alle Verpflegungen schleppt er mit. Als wir am nächsten Tag weiterfahren, entdecken wir häufig Martins Fahrradspur, die zick- zack durch den Sand führt und an manchen Stellen abrupt abbricht: dort hat ihn plötzlich eine Welle mit Weichsand überrascht und er mußte schleunigst vom Fahrrad springen - wenn er nicht schon vorher kopfüber abgeworfen wurde.
Vier Tage nach der Abfahrt in Agadez kommen wir in Tamanrasset - kurz Tam - an, die Hoggar-Piste liegt hinter uns. Tam ist die südlichste auf Asphalt erreichbare Oase in der Sahara. Das nicht häßliche Städtchen ist außerdem der Ausgangspunkt für eine Rundfahrt durch’s Hoggar-Gebirge (genauer: das Atakor-Gebirge im Hoggar). Tam quillt daher über von Touristen, wir ergreifen schon bald nach der Ankunft die Flucht nach vorn und starten zur Atakor- Rundfahrt. Die Strecke ist etwa 200 km lang, sie führt durch eine gigantische Landschaft ausgeglühter Vulkane und Basaltbrocken.
Fast am Ende der Afrika-Reise erleben wir noch einmal einen einsamen Höhepunkt, eine Landschaft, die in dieser monumentalen Strenge, in der Vielzahl von bizarr geformten und verformten Felsen, Felsnadeln und riesigen Felsklötzen nur sehr selten auf der Erde wiederzufinden ist. Vergleichbar scheint sie uns nur mit dem Monument Valley in USA, aber auch das ist bescheidener in Ausdehnung und Vielzahl der Monumente.
Für unser geplagtes Auto ist dieseRundreise noch einmal eine Tortour. Wir haben denn auch alle Mühe, den Bus über ein sehr steiles Stück, das noch dazu 2.500 m hoch liegt, "hinaufzukitzeln"... Die letzten 50 m scheinen zum Verhängnis zu werden, aber wir laden Benzinkanister, Wasser und andere schwere Dinge aus und schaffen dann tatsächlich auch die letzten Meter; viele andere mußten hier aufgeben. Aber jetzt können wir zur Hütte am Assekrem-Berg fahren und zum Gipfel aufsteigen. Von dort oben erleben wir den Sonnenuntergang und - viel eindrucksvoller noch - den Sonnenaufgang zwischen den Zyklopen-Felsklötzen. Ein Schauspiel, bei dem man atemlos Zeuge wird, wie die Sonne zunächst vorsichtig hinter Felsblöcken hervorschaut, dann mutig emporsteigt und wenig später über diese zuvor noch unbesiegbaren Berge triumphiert. Ihre langen, schwarzen Schatten werden zusehends kürzer, die Berge verlieren ihren Schrecken.
Auch nach der Rückkehr von der Rundreise bleiben wir nur kurz in Tam und brechen dann zur letzten Etappe nach Norden auf. Zehn Tage später lassen wir unseren braven Wagen im Bauch einer Fähre nach Genua ausruhen. Aber nicht lange, dann empfangen uns am Brenner Schneeschauer, und nördlich davon sieht es nicht viel besser aus.
Als wir unseren Bus ausgeräumt und beim Kilometerstand von 244.598 in die Garage gestellt haben, versprechen wir ihm weiterhin unverbrüchliche Treue bis "das der Rost uns endgültig scheide". Wir hoffen, daß dieser bittere Zeitpunkt noch vier, vielleicht auch noch sechs Jahre auf sich warten läßt.
Ich kann nicht umhin, diesem Treueschwur eine Liebeserklärung folgen zu lassen. Wir haben ein Blechgehäuse lieben gelernt, das leblos ist und die Umwelt verschmutzt. Aber es war uns auf allen Kontinenten dieser Erde ein Zuhause, unser Zuhause - ob im aufdringlichen Menschengewühl Calcuttas, ob im australischen Busch, der dünnen Luft der Hochanden oder zuletzt in der Einsamkeit der Sahara. Manchmal waren wir auf Gedeih und Verderb einander ausgeliefert, manchmal war es nur ein Verhältnis gegenseitiger Verpflichtungen. Nur ein einziges Mal während der 250.000 km mußte der treue Gefährte mit fremder Kraft in die Werkstatt geschleppt werden, wir haben uns sonst immer auf ihn verlassen können.
Drei Jahre lang war dieses winzige Haus unsere einzige Bleibe, wir erlebten in ihm die glücklichsten Jahre unserer Vergangenheit. Und jedes Mal, wenn wir auch nur für kurze Zeit in unseren braven Bus übersiedeln, erwacht für uns eine andere, unabhängige Wirklichkeit von Fortbewegen, fremden Gerüchen, neuen Erlebnissen.
Hier endete die Geschichte unseres Autos in der vierten Auflage dieses Buches. Inzwischen sind sieben Jahre vergangen, und unser Bus lebt immer noch - allerdings sind seine Tage mit Nummernschild und Benzin im Tank gezählt. Dann, wenn der TÜV uns im Dezember 1986 endgültig scheiden könnte, wollen wir dem Gefährten die Schmach nicht antun und ihm stattdessen das wohlverdiente Gnadenbrot gönnen: Im Deutschen Museum in München hat er seinen letzten Rastplatz gefunden. Dort gehört er zwar zu den ganz Jungen der Autoabteilung, aber schließlich hat er ein ungewöhnliches Autoleben hinter sich.
In diesen sieben Jahren sind wir noch einmal rund 100 000 km mit dem Wagen gefahren, und das keineswegs zu Hause sondern hauptsächlich in Ägypten und Nahost. Doch eigentlich hat diese Zeit für mich zwei abenteuerliche Gesichter.
Das eine Gesicht ist meine berufliche Arbeit. Nach unserer Rückkehr aus Westafrika bot mir mein damaliger Arbeitgeber an, die Geschäftsführung einer neugegründeten Tochterfirma zu übernehmen. Das Unternehmen sollte sich mit einer etwas ungewöhnlichen und neuartigen Dienstleistung beschäftigen: Elektronische Geräte wiederherzustellen, die nach einem Feuer von Ruß und aggressiven Rauchkondensaten oder z.B. durch Überschwemmungen in Mitleidenschaft gezogen worden waren.
Kaum hatten wir die Eröffnungsfeier hinter uns, begann dieser Job, mich mit Haut und Haaren zu fressen und mir praktisch keine Freizeit mehr zu lassen, schlaflose Nächte wechselten mit Euphorie und Erfolgserlebnissen. Doch die Firma konnte alle Fährnisse umschiffen und mußte nach zwei Jahren bereits ein eigenes Betriebsgebäude errichten.
Die sehr spezialisierte Dienstleistung muß über große Räume angeboten werden - was meinen persönlichen Reise-Ambitionen durchaus entgegenkommt. Im Laufe der Jahre haben wir auf allen Kontinenten gearbeitet und Niederlassungen in Europa und Übersee gegründet.
Die erste der Niederlassungen starteten wir 1982 in USA, ganz in der Nähe von New York. Für drei Monate beteiligte ich mich am Aufbau, so zogen Sigrid und unsere pakistanische Hündin Judy mit nach New York. Wir lebten in einem Appartement direkt am Hudson, allerdings auf der anderen Seite Manhattans. Das schien zunächst sehr vorteilhaft, weil wir einen herrlichen Blick über die Skyline von New York hatten. Aber bald merkten wir, daß wir viel lieber direkt im Geschehen, möglichst mitten in Manhattan, gelebt hätten; denn das zum Greifen nahe NY war verkehrsmäßig eine gute Stunde entfernt.
Dennoch zählen diese Monate in New York zu den Höhepunkten der vergangenen Jahre. Wir haben die Stadt, die wir für die faszinierendste der Welt halten, in vielen Phasen erleben können, wir haben sie in allen Himmelsrichtungen erforscht und sie noch mehr lieben gelernt.
Zwar ist New York eins der Hauptziele meiner Geschäftsreisen geblieben. Darüberhinaus habe ich viele Gegenden besucht, die wir vorher per Auto bereisten. Bei einer Vortragsreise nach Bombay und Dehli kam Sigrid mit - und wir konnten nicht verstehen, daß wir Indien viele Jahre lang nicht besucht hatten. Wir nutzten jeden freien Augenblick, durch die Straßen und Bazare zu wandern, mit den Leuten auf der Straße zu sprechen und die vielen Facetten Indiens erneut und gierig aufzusaugen. Als die Inder, mit denen ich geschäftlich zu tun hatte, unser Interesse am Land bemerkten, wurden wir mit Einladungen überhäuft. Häufig diskutierten wir bis zum frühen Morgen über den Subkontinent und seine Probleme.
Das zweite Gesicht der wie im Flug vergangenen sieben Jahre ist unsere Freundschaft mit Ägypten. Weil ich nur relativ kurz Urlaub nehmen konnte, suchten wir Ende 1980 ein nahes, aber doch reizvolles Ziel. Unsere Wahl fiel auf Ägypten. Wir verschifften unseren Bus nach Alexandria und verbrachten drei Wochen auf den üblichen Routen der Ägypten-Bildungsreisenden. Von Kairo und seinem so typisch orientalischen Leben waren wir hellauf begeistert. Doch der Nepp vor allem in den Tourismushochburgen und das Anbiedern der Ägypter im Tourismusgeschäft stießen uns zunächst ab. Zu Hause verblaßten diese negativen Eindrücke bald, wir flogen für einen zweiten Besuch ins Land am Nil. Diesmal nahmen wir einen Mietwagen und fuhren durch die Oasen der westlichen Wüste und auf den Sinai - niemand belästigte uns, wir trafen offene, herzlich-freundliche Menschen.Und wir entdeckten eine Landschaft, die wir in ihrer wüsteneinsamen Schönheit und ihrer Vielfalt nicht erwartet hatten.
Es begann auf der Strecke zwischen den Oasen Bahariya und Kharga, die auf relativ geringe Entfernung ein ungeheuer abwechslungsreiches Bild von Wüstenlandschaften bietet. Hinter Bahariya wechseln die schwarz mit Basaltbrocken übersäten Zeugenberge plötzlich in die gletschergleiche "Weiße Wüste" über. Hier hat die Erosion Pilze, Kegel, Säulen und Dome aus dem weißen Kalksteinuntergrund herausgefräßt und aus ihnen einem phantasievollen Kunst-Park geschaffen. Wir erlebten diese Ansammlung skurriler Gestalten zum ersten Mal in einer Vollmondnacht und wußten nicht, ob es Traum oder Wirklichkeit sei.
Dann folgt die weltvergessene kleine Oase Farafra mit ihren etwas zurückhaltenden, aber von Herzen freundlichen Menschen. Später führt die Straße ganz in die Nähe der 150 Meter hohen Dünenkämme des Großen Sandmeeres vorbei, durchquert lauschige Dörfer der Oase Dakhla, windet sich schließlich kurz vor Kharga um Dünenkämme und berührt mit einer Stichstraße bei El Maks die südlichste Siedlung Ägyptens.
Eine ebenfalls phantastische Landschaftskulisse erlebten wir in der Arabischen Wüste zwischen Nil und Rotem Meer, aber noch gewaltiger wird der Eindruck auf dem gegenüberliegenden Sinai. Die herrischen Granit-Hochgebirge im Süden sind geologisch mit denen der arabischen Wüste verwandt, doch auf dem Sinai türmen sie sich höher hinauf, sind zerklüfteter und von vielen Wadis durchzogen. Zum Osten hin stürzen sie in den Golf von Aqaba und schmücken sich mit den schönsten Korallengärten der Welt. An die Hochgebirge schließt sich nach Norden hin die Wüste Tih ("Wüste des Irrens") an, eine brettflache Landschaft wirklich zum Irren, die am Mittelmeer in Dünenketten ausläuft. Doch zum Sinai gehören auch die stolzen Beduinen, die, eng verbunden mit der Wüste, ihren Lebensunterhalt der kargen Umgebung abringen.
Als wir dieses andere Ägypten erlebt hatten und in keinem Reiseführer erwähnt fanden, beschlossen wir, das so positive Erlebnis in einem Führer zu beschreiben, der andere vor unseren ersten Fehlschlüssen bewahren sollte.
Zur Buchmesse 1983 erschien "Ägypten für Globetrotter", ein paar Tage später brachen wir mit unserem VW-Bus zur vierten Ägyptenreise auf, im Herbst 1985 folgte die fünfte und, wie kann es anders sein, im Herbst 1986 die sechste. Für diese Reise allerdings wählten wir als Anfahrt den Landweg, d.h. wir fuhren durch die Türkei nach Syrien und weiter in’s für uns bis dahin unbekannte Jordanien. Von diesem Land waren wir sehr positiv beeindruckt: freundliche Menschen, die sich offenbar redlich bemühen, ihr Wüstenland - wo immer es geht - in einen Garten zu verwandeln.
Wir machten einen langgehegten Traum wahr und besuchten die Felsenstadt Petra, die uns so begeisterte, daß sie bestimmt zum bereits geplanten nächsten Jordanienbesuch gehören wird. Schließlich verschifften wir unseren Bus auf der neuen Fährlinie von Aqaba nach Nuveiba auf dem Sinai.
Unser Ägyptenführer - der guten Anklang fand und inzwischen bereits in der sechsten Auflage erschienen ist - brachte uns eine weitere, recht ungewöhnliche Ägyptenreise ein: Im Frühjahr 1986 wurden wir als Berater für einen Film angeheuert, der unter dem Titel "Kulturen im Sand" im Gebiet der Libyschen Wüste spielt. Sponsor des Films war das VW-Werk, das drei Synchro-VW-Busse zur Verfügung stellte.
Dieser ungewöhnliche Job machte sehr viel Spaß - und zeigte uns, was man mit allradgetriebenen Fahrzeugen in der Wüste unternehmen kann. Wir erlebten völlig neue Freiheitsgrade im Gelände und beschlossen spontan: dieses Modell wird unser nächster Campingbus sein. Kaum zurückgekehrt, bestellten wir das Fahrzeug. Inzwischen haben wir kräftig zugepackt und das leere Blechgehäuse mit einer Wohneinrichtung versehen, die zwar der alten ähnelt, aber doch einige Unterschiede aufweist. Das Ergebnis beschreiben wir in Teil III, Kapitel 13 dieses Buches.
So schließt sich ein bißchen der Kreis unserer Erlebnisse mit dem alten VW-Bus, der neue steht "mit kratzenden Hufen" in der Garage und wartet auf seine erste große Reise,die ihn demnächst auf den Sinai und ins übrige Ägypten führen soll. Aber das wird nur der Beginn eines hoffentlich ähnlich langen und ähnlich erlebnisreichen Autolebens sein.
Erneut sind zwei Jahre wie im Flug vergangen. Jetzt, im frühen Frühjahr 1989, bereiten wir die sechste Auflage dieses Buches vor und werden, sobald die Vorlagen in der Druckerei sind, auf eine Ägyptenreise gehen, die uns neun Wochen durch unsre "Zweite Heimat" führen soll.
Natürlich sind wir mit unserem neuen VW-Bus unterwegs, den wir mit viel Freude fahren. Allerdings leiden wir sehr unter den Qualitätsmängeln des Fahrzeugs, die wir in diesem Ausmaß nicht erwartet hätten - vielleicht haben wir ein "Montagsauto" erwischt. Nach den Erfahrungen mit demQualitätsstandard dieses Wagens überlegen wir ernsthaft, ob wir je wieder ein Produkt der VW AG kaufen werden.
Unser Leben hat auch mal wieder eine neue Wendung genommen. Nach zehn arbeitsreichen Jahren wollte ich mich wieder etwas mehr dem Reise-Leben widmen und konnte nach längeren Verhandlungen meinen Geschäftsführervertrag für die nächsten drei Jahre in eine Teilzeitbeschäftigung umwandeln, eine nicht gerade alltägliche Lösung in Managerkreisen. Meine Arbeitszeit verteilt sich je nach Bedarf monatsweise zwischen Firma und Privatisieren.
Einen ersten Vorgeschmack auf das künftige Leben hatten wir zu Beginn dieses Jahres mit einer Reise durch Namibia, der letzten, kurz vor der Unabhängigkeit stehenden Kolonie Afrikas. Mit einem Mietwagen durchstreiften wir das riesige, eigentlich menschenleere Land von Nord nach Süd. Wir erlebten fantastische Wüstenstimmungen, weil stellenweise ungewöhnlich ergiebige Regen den Boden in ein Blütenmeer - für Wüstenverhältnisse - versetzt hatten.
So ist der erste Schritt in eine wieder einmal etwas spannende Zukunft getan - unsere Köpfe schwirren von neuen Reiseplänen.